Metallsalze und Metallsalzabscheidung
Weitere Versuche mit der in Figur 13 dargestellten Apparatur machten Metallsalzbildung und Metallabscheidung beobachtbar.
- Ritter befüllte die Apparatur mit schwefelsaurer Kupferauflösung und verwendete Eisendrähte. Hierbei war "außerhalb der Kette", das heißt, solang der Stromkreis nicht geschlossen war, eine "Niederschlagung des metallischen Kupfers auf beide Drähte in gleichem Grade", bei geschlossenem Kreis, "in der Kette", ein starker Niederschlag bei a und ein geringer bei b sichtbar.
- Bei Befüllung mit schwefelsaurer Kupferlösung und Drähten aus Kupfer konnte man außer der Kette nichts beobachten, es blieb "alles in Ruhe" und in der Kette bei a ein "oxidieren und in Flüssigkeit auflösen" und bei b ein Niederschlag von "Kupfer aus Kupferauflösung auf Kupfer metallisch".
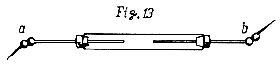
Wassergefülltes Glasrohr für Elektrolysen mit zwei Metalldrähten, die an die Pole einer Voltaschen Säule angeschlossen werden
Analog zu obigen beiden Versuchen mit anderen Metallen.
"Aber nicht bloß mit gleichen Metallen, auch wenn die Materie
der Drähte an Oxidabilität der in der Säure der Flüssigkeit
aufgelösten weit, ja ganz nachsteht, fand diese Niederschlagung statt.
Solche Fälle sind:
| a und b = | Kupfer; | Inhalt der Röhre = | Zinkauflösung | |
| a und b = | Silber; | Inhalt der Röhre = | Zink- oder Kupferauflösung | |
| a und b = | Gold; | Inhalt der Röhre = | Zink- oder Kupfer- oder Silberauflösung |
"Wärme, deren Einfluss auf die Wirksamkeit der Batterie ich schon oben erwähnte, beschleunigt übrigens in allen zum Versuch in Röhren, wie in Figur 13, genommenen Flüssigkeiten den in ihnen angeregten Prozess jedes mal oder macht ihn auch wohl erst möglich, wenn er vorher noch fehlte. Kälte derselben hingegen schwächt den vorhandenen oder hebt ihn auch ganz auf."