Wiederholung von Nicholsons (1753-1815) Versuch
"Wir brachten in eine mit Wasser gefüllte Glasröhre (Figur
13) zwei Messingdrähte a und b und verbanden den ersteren durch andere
Drähte mit dem Zink, den anderen mit dem Silber der Batterie. Sogleich
zeigten sich an der Spitze von b eine Menge ganz kleiner, schnell in die
Höhe steigender Bläschen, indes sich die Spitze des anderen
mit einer äußerst zarten Wolke von Messingkalk umgab."
Ritter stellte fest, dass diese Reaktion umkehrbar war; vertauschte man
die Anschlüsse, so entstanden an a Bläschen, während b
verkalkte. Auch machte er ähnliche Versuche mit "Drähten
oder Stangen von Zink, Zinn, Blei, Eisen, Kupfer und Wismut", bei
denen er analoge Beobachtungen festhielt. Verwendete man hingegen zwei
Drähte aus Gold, "zeigte sich die Gasentwicklung noch sehr lebhaft,
ja, auch der andere Draht, der vorher, wenn er von irgend einem anderen
Metall war, verkalkt wurde, gab jetzt Gas. Die Menge der Bläschen,
die an a (d.i. an dem mit dem Zink verbundenen Drahte) erschienen, war
beträchtlich geringer als die an b (d.i. der mit dem Silber verbundenen
Drahte)" (Anm.: d.i. = das ist). Da an a bisher immer eine Verkalkung
stattgefunden hatte, nahm Ritter an, es handele sich bei dem erzeugten
Gas um Sauerstoff.
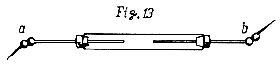
Wassergefülltes Glasrohr für Elektrolysen mit zwei Metalldrähten, die an die Pole einer Voltaschen Säule angeschlossen werden
Entwurf eines neuen Apparates für genauere Messungen
"Figur 14 stellt den Apparat vor, dessen wir uns hierzu bedienten.
In die gegenüberliegenden Seitenwände einer Schale von Marmor
bohrten wir zwei Löcher, und steckten durch jedes, vermittelst Korkstöpseln,
einen der Golddrähte, wie wir sie vorhin gebraucht hatten. Die gasgebenden
Enden der Drähte standen einen reichlichen Zoll voneinander und die
Drähte selbst waren, damit nichts von dem Gas, was sich ohne dies
auch zu anderen von jenen Enden entfernteren Stellen, wenn auch minder
häufig, entwickelt haben würde, wegen zu kleiner Öffnung
der auffangenden Gefäße seitwärts verloren gehen könne,
so weit mit Wachs überzogen, dass sie höchstens in der Lage
eines halben Zolls an jedem Ende frei davon blieben. Darauf wurde das
Gefäß mit Wasser gefüllt und über das entblößte
Ende jedes Drahtes eine oben verschlossene, mit Wasser gefüllte Glasröhre
so gestürzt, dass sie es ganz bedeckte und oben durch ein zur Seite
angebrachtes Gestell festgehalten wurde. Noch setzte ich unter jeden Draht
ein kleines Glas, um darin, was sich etwa während diesem zur längerer
Dauer bestimmten Versuch von Goldkalk u.s.w. zeigen könnte, aufzufangen.
Jetzt brachte ich den Knopf des Drahtes linker Hand, a, mit dem Zink der
Batterie, den des Drahtes rechter Hand, b, aber mit dem Silber derselben
in Verbindung"
Nach 16 Stunden Versuchsdauer stellte Ritter ein Gasvolumen von 1 (bei
a) zu 2,5 (bei b) fest. Das Gas, das an a entstand, identifizierte er
mittels vollständiger Verbrennung als Sauerstoff, das an b entstandene
mittels Knallgasprobe als Wasserstoff.
"So ist es also durch Versuche nun nicht bloß auf das Vollständigste
erwiesen, dass die bei der Einwirkung des verstärkten Galvanismus
auf Wasser erzeugten beiden Gasarten, das Hydrogen wie das Oxygen, keineswegs
von einer sogenannten Zersetzung des Wassers herrühren können,
sondern überdies noch: dass auch die Erzeugung jeder Gasart ein Prozess
sei, der ganz und gar nicht mit dem der Erzeugung des anderen zusammenhänge,
sondern dass beide durchaus ganz unabhängig voneinander und einzeln
stattfinden können."
Anm.: Mit letzter Aussage irrte Ritter.
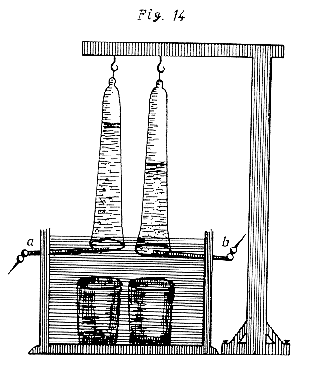
Ritters Wasserelektrolysier-Apparat