Warum Wissenschaft Vielfalt braucht
Führt mangelnde Vielfalt in der Wissenschaft zu einseitigen Forschungsergebnissen? Darüber diskutiert die Wissenschaftstheorie seit Jahrzehnten. Maßnahmen für mehr Diversität gibt es viele, und nicht alle sind unumstritten. Die Leiterin des Humboldt-Zentrums Professorin Rebekka Hufendiek erklärt, weshalb es für gute Forschung so wichtig ist, eigene Prägungen zu hinterfragen, welchen Einfluss Vorurteile auf wissenschaftliche Erkenntnisse haben – und wie ein Fruchtfliegen-Experiment im 20. Jahrhundert den Blick auf Geschlechterverhältnisse geprägt hat.
Sie ist klitzeklein, geht so ziemlich jedem auf die Nerven – und hat über ein halbes Jahrhundert hinweg den Blick der Wissenschaft auf die Geschlechterverhältnisse im Tierreich geprägt. Fast achtzig Jahre ist es her, dass die Fruchtfliege die Hauptrolle in einer wegweisenden Studie spielte: 1948 untersuchte der britische Biologe Angus Bateman ihr Paarungsverhalten und kam zu dem Schluss, dass einige wenige Männchen viele Partnerinnen und dadurch auch mehr Nachkommen hatten als die meisten anderen Männchen: Die Variabilität im Paarungserfolg bei Männchen sei größer als bei den Weibchen. Seine Forschung sollte zur Quelle einer Flut von Behauptungen über die psychologischen und evolutionären Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden. So formuliert es Cordelia Fine in ihrem Buch »Testosterone Rex«, in dem sie Mythen rund ums biologische Geschlecht auf den Grund geht.
Batemans Studienergebnisse wurde zum empirischen Beleg der bereits von Charles Darwin entwickelten Theorie der sexuellen Selektion. Deren Grundidee: Männchen konkurrieren, Weibchen selektieren. Bis ins 21. Jahrhundert wurde die Drosophila-Studie weder repliziert noch genauer überprüft. Dass die Datenlage seine Schlussfolgerungen gar nicht stützt, stellten erst 2007 Brian Snyder und Patricia Gowaty fest: mit einer besseren Methodik und »50 Jahren feministischer Erkenntnisse darüber, wie kulturelle Überzeugungen den wissenschaftlichen Prozess beeinflussen können«, wie Fine schreibt. Snyder und Gowaty überprüften Batemans Experimente und zeigten, dass durch Promiskuität sowohl männliche als auch weibliche Fruchtfliegen mehr Nachkommen hatten. Inzwischen weiß die Forschung, dass das quer durchs Tierreich gilt. Zwar gibt es eine Tendenz dazu, dass der reproduktive Erfolg promisker Männchen größer ist, doch das trifft bei Weitem nicht auf alle Arten zu.
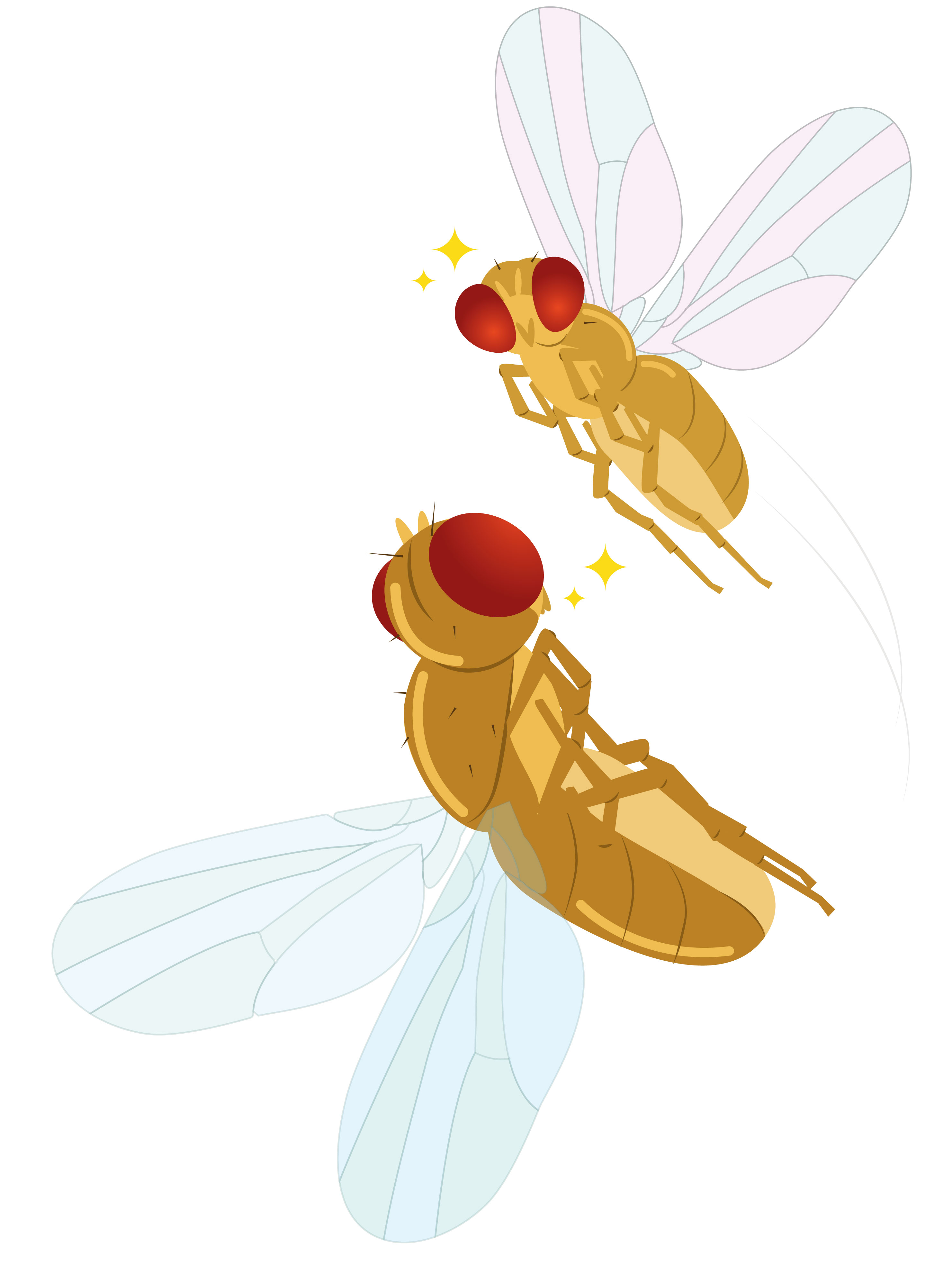
Für Professorin Rebekka Hufendiek ist das Drosophila-Experiment ein gutes Beispiel dafür, wie kulturelle Prägung Wissenschaft beeinflussen kann: Bateman baute seine Forschung auf Darwins Theorie der sexuellen Selektion auf – und der wiederum war ein Kind seiner Zeit mit ihren viktorianischen Stereotypen und Moralvorstellungen. »Darwin stellte sich vor, dass die sexuelle Selektion artübergreifend zu Dominanzverhalten und Promiskuität bei den männlichen Mitgliedern einer Spezies und zu wählerischem Verhalten, Monogamie und ausgeprägterem Fürsorgeverhalten bei den Weibchen führt«, erläutert Hufendiek. Als Leiterin des Humboldt-Zentrums der Universität Ulm ist Hufendiek auch dafür zuständig, die Studierenden zu motivieren, über wissenschaftliche Erkenntnisprozesse zu reflektieren und sie dafür zu sensibilisieren, wie sich eigene Vorurteile nachteilig auf die Forschung auswirken können. Erklären, dass objektive Forschungsergebnisse »nicht vom Himmel fallen« und erarbeiten, wie man sich ihnen annähern kann: Das sei die Aufgabe der Wissenschaftstheorie. Dabei gelte: »Es gibt nicht nur das subjektive Erleben auf der einen Seite und die objektive Forschung auf der anderen. Objektivität herstellen ist ein vielschichtiger gradueller Prozess.«
Grundsätzlich gibt es zwei Argumentationswege, mit denen man für Vielfalt in der Wissenschaft plädieren kann, so Hufendiek. Zum einen das moralische Argument: Die Ausbildung an der Universität und die Chance auf eine wissenschaftliche Karriere sollten allen Menschen offenstehen – unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft. »Diesen Anspruch kann man an Universitäten als Wissenschaft betreibende Institutionen formulieren – und er ist in liberalen Demokratien auch relativ unstrittig«, sagt Hufendiek. Worüber allerdings gestritten werde, seien viele der Maßnahmen, die unter das Label »affirmative action« fallen, also die spezifische Förderung und Ermutigung von unterrepräsentierten Gruppen. Wenn durch diese eine Ungleichbehandlung entstehe, seien diese immer rechtfertigungsbedürftig. Hufendiek ist aber überzeugt, dass viele Aktionen, die der Gleichstellung dienen, so realisiert werden können, dass sie letztlich allen zugutekommen. »Ich habe oft erlebt, dass in der universitären Ausbildung unfaire Selektionsmechanismen greifen. Etwa, wenn Kolloquien abends stattfinden, man danach noch etwas trinken geht und dann die Person die Aufmerksamkeit des Professors bekommt, die immer beim Bier dabei ist und den Tisch unterhält. Das sind aber weder faire noch gute Selektionsmechanismen für exzellente Arbeit.« Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses profitiere allgemein davon, wenn man sich hier Gedanken über Good Practice mache, die Erwartungen im Ausbildungsprozess transparent mache oder familienfreundliche Arbeitszeiten etabliere. »Wenn man solche Maßnahmen umsetzt, kommt das allen gleichermaßen zugute«, ist Hufendiek überzeugt. »Wenn man es nicht tut, schadet es unterrepräsentierten Gruppen aber stärker.«
Wir haben alle einen sozial situierten Blick auf die Welt. Das beste Mittel dagegen sind wissenschaftliche Methoden und diverse Perspektiven
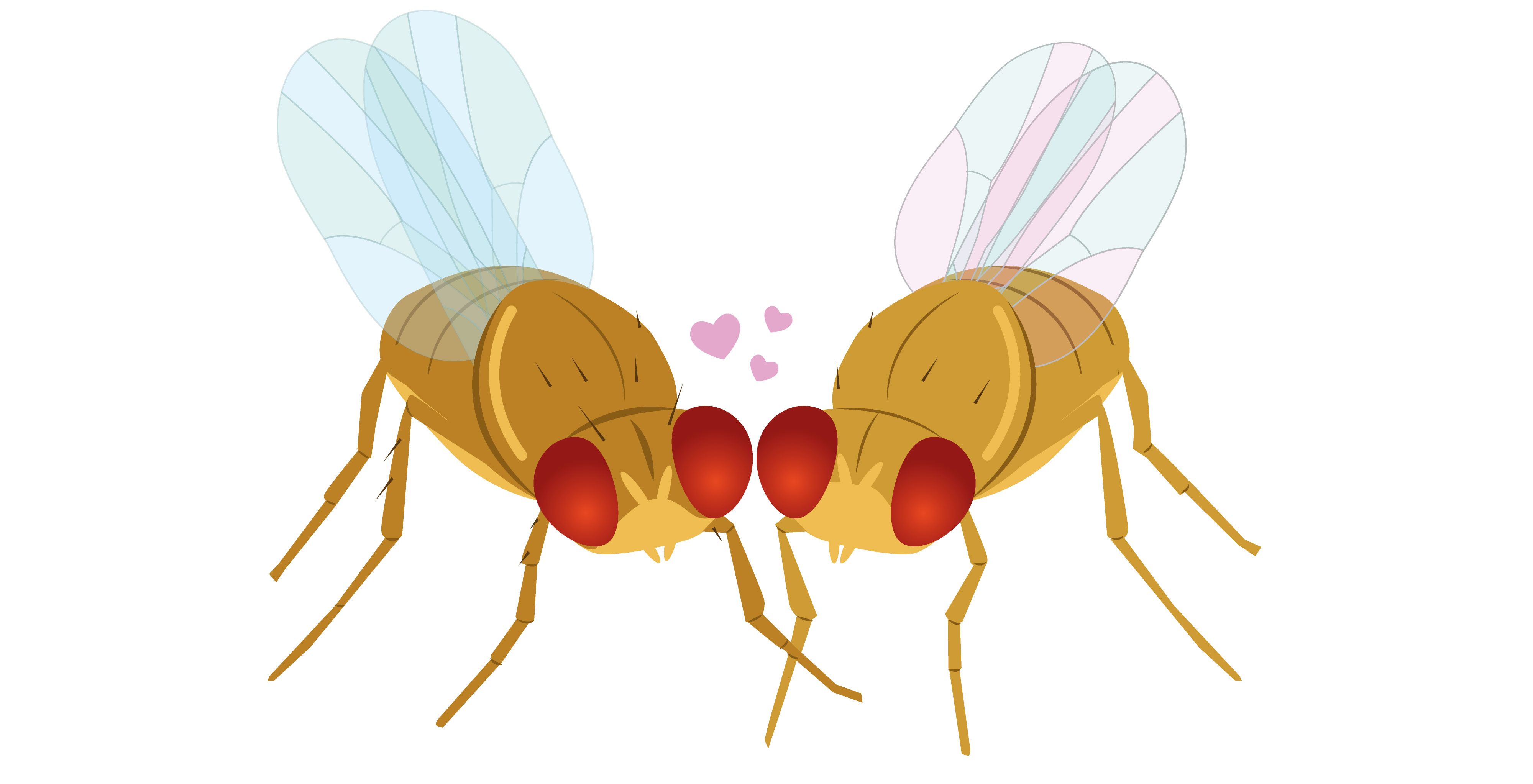

Im Kontext der Wissenschaftstheorie interessanter findet die Philosophie-Professorin das epistemische Argument, das die Erkenntnisqualität wissenschaftlicher Forschung betrifft. Seit Jahrzehnten diskutiert die Wissenschaftstheorie darüber, inwiefern mangelnde Vielfalt zu voreingenommenen oder einseitigen Forschungsergebnissen führen kann. Oder andersherum: Sind vielfältige Perspektiven nicht essenziell im nach Objektivität strebenden Erkenntnisprozess? Dabei geht es um weit mehr als nur um eine theoretische Diskussion. Denn der Mangel an Vielfalt hat handfeste praktische Folgen, die oftmals das Leben vieler Menschen betreffen. Künstliche Intelligenz etwa erkennt die Gesichter Schwarzer Menschen viel schlechter als jene von Weißen, was erst spät erkannt wurde. Ein anderes Beispiel: Vor der Freigabe der Corona-Impfung wurde deren Auswirkung auf den weiblichen Zyklus nicht untersucht. Inzwischen ist zwar nachgewiesen, dass die durch die Impfung verursachten Unregelmäßigkeiten harmlos sind. »Bis entsprechende Studien erschienen, hatten sich jedoch längst wilde Theorien über negative Einflüsse auf die Fruchtbarkeit verbreitet«, erläutert Hufendiek. Es sei unverantwortlich, in einer Pandemie mögliche Auswirkungen auf die Hälfte der Menschheit einfach zu vergessen: »Hier wurde massiv Vertrauen in die Wissenschaft verspielt, und das hätte verhindert werden können.«
Ihr Umfeld prägt alle Menschen, und dennoch sind die meisten überzeugt, keine Vorurteile zu haben. Wie kann es also gelingen, den eigenen Bias zu erkennen? Rebekka Hufendiek hat ein paar Faustregeln für Individuen parat: Reflektieren, ob man nicht doch Vorurteile hat. Üben, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Und sich Feedback unterschiedlicher Art einholen. »Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Maßnahmen aber struktureller Natur«, so die 44-Jährige. »Wir alle haben einen sozial situierten Blick auf die Welt. Das beste Mittel dagegen bieten zum einen wissenschaftliche Methoden, die sich um Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit bemühen, und zum anderen natürlich möglichst diverse Perspektiven auf ein- und denselben Forschungsgegenstand.« Denn man bekomme viel eher gute Resultate, wenn man unterschiedliche Menschen in die Forschung einbindet. »Offensichtlich ist es nicht notwendig, dass Schwarze Menschen selbst an der Forschung beteiligt sind, damit jemandem auffällt, dass KI ihre Gesichter nicht gut erkennt oder dass Frauen an der Forschung beteiligt sind, damit jemand daran denkt, dass Hormon- und Immunsystem eng zusammenhängen. Diese Dinge können theoretisch alle Menschen herausfinden«, sagt Hufendiek. Die zahlreichen Beispiele der letzten Jahrzehnte zeigten jedoch, dass das in der Praxis häufig erst passiere, wenn auch Menschen an der Forschung beteiligt seien, für die diese Erkenntnisse einen realen Unterschied machen.
Was all das mit der Fruchtfliege zu tun hat? Die genetische Forschung war lange eine männliche Domäne. »Als mehr Frauen in die Genetik kamen, wurden die Theorien mit Blick auf sexistische Vorurteile differenzierter«, so Hufendiek. »Wir wissen jetzt, dass weder Promiskuität noch Wettbewerb exklusiv männliche Verhaltensweisen sind.« Diese Erkenntnisse seien allen gleichermaßen zugänglich. »Dass wir aber auch tatsächlich zu ihnen gelangen, wird viel wahrscheinlicher, wenn die betroffenen Gruppen auch an der Erkenntnis beteiligt sind«.
Sechs Grundpfeiler der Objektivität
Die Wissenschaftstheoretikerin Heather Douglas geht davon aus, dass es sechs Grundpfeiler der Objektivität gibt, die alle graduell zu verstehen sind, denen wir uns mehr oder weniger annähern können:
- Manipulative Objektivität: Experimente zeigen den gleichen Effekt
- Konvergente Objektivität: Verschiedene Studienformate kommen zu übereinstimmenden Ergebnissen
- Distanzierte Objektivität: Wertannahmen sollen nicht an die Stelle von Evidenz treten
- Prozedurale Objektivität: Man gelangt durch Anwendung eines nachvollziehbaren Verfahrens zu einem Ergebnis
- Konsensuale Objektivität: Eine Gruppe einigt sich auf ein Verständnis einer Sache
- Interaktive Objektivität: Viele verschiedene Stimmen werden gehört und nach jeweiliger Kompetenz abgewogen
»Gute Forschung bemüht sich um Objektivität und berücksichtigt diese Aspekte«, sagt Professorin Hufendiek. Je nach Kontext könne sich allerdings stark unterscheiden, welche besonders relevant sind und welche weniger.
Douglas, Heather. 2009. Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press
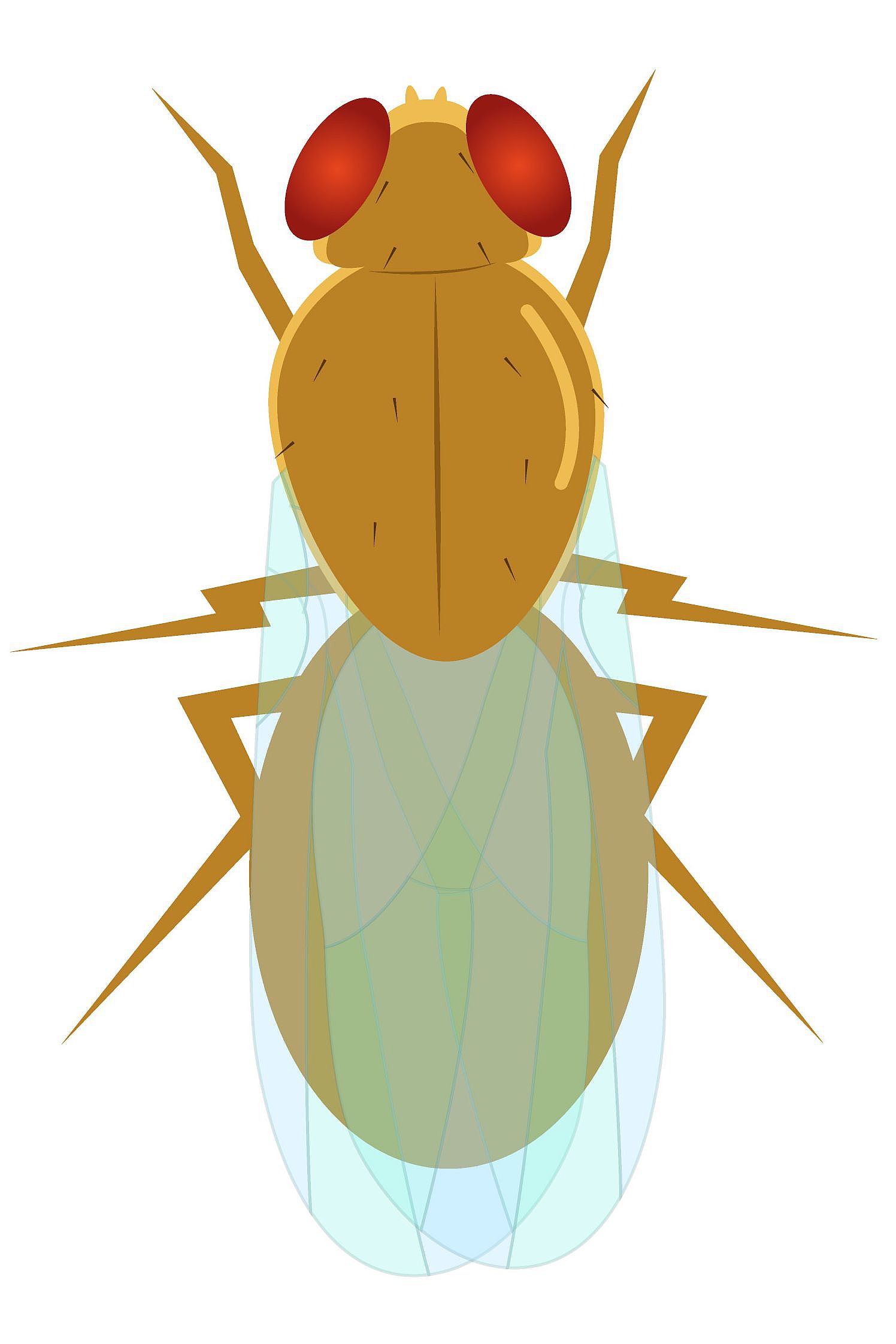
Interview: Christine Liebhardt
Illustrationen: Beniamino Raiola
Foto: Volkmar Könneke
