»Die Menschen werden anfälliger für psychische Erkrankungen«
Professor Carlos Schönfeldt-Lecuona beleuchtet, warum immer mehr Menschen psychisch stark belastet sind
Krisen und Konflikte überall: Erst kam die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt auch noch der neue Nahost-Konflikt; all das vor weltweiten Herausforderungen wie Klimawandel und Migration. Nun häufen sich Berichte, dass die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen stark zugenommen hat. Doch daran ist nicht allein die schwierige Weltlage schuld. Welche Faktoren für diese Zunahme noch verantwortlich sind, erklärt Professor Carlos Schönfeldt-Lecuona. Der Mediziner ist Stellvertretender Leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III des Universitätsklinikums Ulm.
Herr Professor Schönfeldt-Lecuona, wie steht es um unsere psychische Gesundheit?
»In der Tat hat die psychische Belastung der Bevölkerung in den letzten Jahren in den Industrieländern insgesamt zugenommen. Gründe dafür sind unter anderem Veränderungen soziofamiliärer und beruflicher Strukturen. Heute stehen die Menschen allgemein stärker unter Stress. In Kombination mit weiteren Faktoren senkt dies die Schwelle für die Entwicklung psychischer Erkrankungen. Die Menschen werden anfälliger für psychische Störungen und indirekt auch für körperliche Leiden.«
Was sind konkrete Gründe für die Zunahme an psychischen Erkrankungen?
»Zum einen sind dies die zunehmende Arbeitsbelastung und die Digitalisierung. Die Verdichtung der Arbeit und die Rationalisierung von Arbeitsplätzen haben zu einer höheren Arbeitsbelastung pro Kopf geführt. Durch die zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen sehen sich Menschen in vielen Branchen ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert, was ernsthafte Belastungen verursacht. Eine weitere Rolle spielt auch die Veränderung familiärer Strukturen. Früher waren die Familien größer, und die Mitglieder konnten sich gegenseitig stützen. Die Jüngeren profitierten von den Älteren, und die Älteren wurden oft bis zum Ende ihres Lebens von den Jüngeren zu Hause behalten und gepflegt. Diese Strukturen haben sich verändert, und die Unterstützung innerhalb der Familien ist nicht mehr so ausgeprägt.«
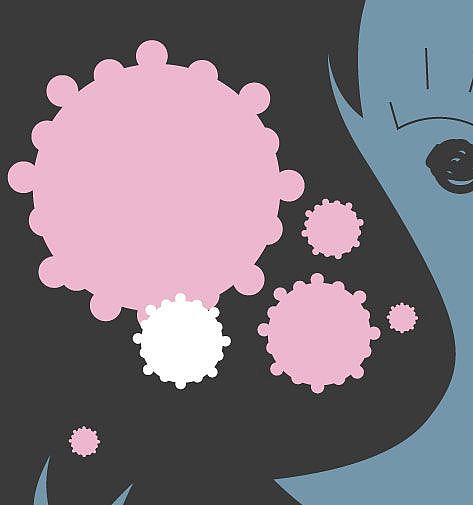
Welche Rolle spielen die digitalen Medien?
»Internet und digitale Medien sind omnipräsent. Heute lernen Kinder und Jugendliche mehr aus YouTube-Videos und Sozialen Medien wie Instagram oder TikTok als in der Schule oder zu Hause von ihren Eltern und Geschwistern. Dieses Wissen ist oft stark durch wirtschaftliche Interessen manipuliert. Deren Ziel ist es nicht, den Menschen zu fördern, sondern den kontinuierlichen Medienkonsum zu befeuern; zudem kann die dauerhafte Nutzung digitaler Medien zu Suchtverhalten, Stress oder sogar zur Traumatisierung führen.«
Was hat sich über die Zeit noch verändert?
»Die Spiritualität hat deutlich abgenommen, und das Wertefundament der Gesellschaft hat sich stark verändert. Es gibt eine Tendenz zu mehr Oberflächlichkeit und Materialismus. Der moderne Mensch ist außerdem weniger resilient, und gerade Jugendliche leiden häufig an einem Mangel an Selbstwirksamkeit. Probleme werden oft mit legalen und illegalen Substanzen kompensiert. Der Konsum von Drogen erhöht wiederum die Anfälligkeit für psychische und körperliche Erkrankungen.«
Welche psychischen Erkrankungen sind häufiger als früher?
»Besonders stark – wie mehrere Studien belegen – ist der Zuwachs bei Depressionen, Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Bei Kindern und Jugendlichen nehmen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom, Suchterkrankungen, Essstörungen und Störungen des Sozialverhaltens zu. Die Prävalenz psychischer Erkrankungen ist im Vergleich zu vor 50 Jahren höher. Die Frage ist nun, ob diese Zunahme darauf zurückzuführen ist, dass mehr Menschen von diesen Krankheiten betroffen sind oder ob die Menschen sensibler geworden sind und häufiger ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.«
Gibt es hier einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie?
»Depressionen und Angststörungen haben während dieser Zeit weltweit um etwa 25 Prozent zugenommen. Wir gehen in der Tat davon aus, dass die COVID-19-Pandemie zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen geführt hat – auch in Ulm. Es ist jedoch schwer, diese Frage anhand unserer Belegungszahlen zu beantworten, da stationäre Behandlungen während der Pandemie infektionsbedingt nicht auf Volllast liefen. Es gab ungeplant Entlassungen aufgrund von Infektionen, und nicht entlassungsfähige Patienten mussten im Mehrbettzimmer einzeln isoliert behandelt werden; die Tagesklinikplätze wurden aus hygienischen Gründen halbiert, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkte.«
Welche psychischen Erkrankungen sind häufiger als früher?
»Besonders stark – wie mehrere Studien belegen – ist der Zuwachs bei Depressionen, Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Bei Kindern und Jugendlichen nehmen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom, Suchterkrankungen, Essstörungen und Störungen des Sozialverhaltens zu. Die Prävalenz psychischer Erkrankungen ist im Vergleich zu vor 50 Jahren höher. Die Frage ist nun, ob diese Zunahme darauf zurückzuführen ist, dass mehr Menschen von diesen Krankheiten betroffen sind oder ob die Menschen sensibler geworden sind und häufiger ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.«
Gibt es hier einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie?
»Depressionen und Angststörungen haben während dieser Zeit weltweit um etwa 25 Prozent zugenommen. Wir gehen in der Tat davon aus, dass die COVID-19-Pandemie zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen geführt hat – auch in Ulm. Es ist jedoch schwer, diese Frage anhand unserer Belegungszahlen zu beantworten, da stationäre Behandlungen während der Pandemie infektionsbedingt nicht auf Volllast liefen. Es gab ungeplant Entlassungen aufgrund von Infektionen, und nicht entlassungsfähige Patienten mussten im Mehrbettzimmer einzeln isoliert behandelt werden; die Tagesklinikplätze wurden aus hygienischen Gründen halbiert, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkte.«
Wie haben sich denn die Patientenzahlen in den letzten Jahren verändert?
»Es ist schwer zu sagen, ob es an der Ulmer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III einen Anstieg an Patientenzahlen gab. Denn die Klinik hat eine feste Anzahl von Betten, nämlich 69, und 24 Plätze für teilstationäre Patientinnen und Patienten. Aus strukturellen und finanziellen Gründen können diese nicht überschritten werden. Seit der Gründung im Jahr 1998 ist die Klinik jedoch signifikant gewachsen. Stationen wurden erweitert und die Ambulanz ausgebaut; dies alles, um den steigenden Bedarf an psychiatrischer Versorgung zu decken.«
Welche therapeutischen Ansätze kommen in diesem Bereich in der Psychiatrischen Uniklinik zum Einsatz?
»Wir sind eine allgemeinpsychiatrische Klinik und behandeln alle Störungsbilder der Psychiatrie, schwerpunktmäßig bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren. Als Klinik sind wir mit psychopharmakologischen, psychotherapeutischen und co-therapeutischen Ansätzen recht breit aufgestellt. In den letzten Jahren wurden außerdem spezialisierte Ansätze implementiert zur Therapie von Persönlichkeitsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder depressiven Störungen.«

Was kann Ihrer Meinung nach die Politik tun, um die Situation für Betroffene zu verbessern?
»Menschen mit psychischen Erkrankungen werden auch heute noch in unserer Gesellschaft stigmatisiert. Es braucht bereits in den Schulen eine bessere Aufklärung und Sensibilisierung für psychische Krankheiten, beispielsweise durch geschulte Lehrkräfte oder durch Fachleute wie Psychiater und Psychologen. Wichtig wäre auch der Ausbau von Präventions- und Informationsprogrammen, sowie die Aufstockung von Beratungsstellen, Angehörigen- und Selbsthilfegruppen. Außerdem sollte die Politik Maßnahmen ergreifen, um den Konsum von Suchtmitteln zu reduzieren, ohne notwendigerweise eine Legalisierung voranzutreiben.
Bei der psychiatrischen Versorgung muss das Wohl des Patienten im Mittelpunkt stehen und nicht finanzielle Überlegungen. Pauschalsysteme sind in der Psychiatrie oft ungünstig, da die individuellen Verläufe sehr unterschiedlich sein können.«
Was kann man selbst für seine psychische Gesundheit und Resilienz tun?
»Es gibt keine Pauschalformel für alle, aber hilfreich ist eine gute Tagesstruktur, ausreichend Schlaf, begrenzter Medienkonsum, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und regelmäßige Entspannungsübungen. Förderlich sind auch
soziale Kontakte und erfüllende Hobbys. Übergewicht sollte vermieden und körperliche Erkrankungen behandelt werden, denn auch die physische Seite spielt bei der Entstehung psychischer Krankheiten eine große Rolle.«
Was ist wichtig im Umgang mit Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden?
»Wichtig in der therapeutischen Arbeit ist ein empathisches und authentisches Auftreten sowie Geduld. Psychische Erkrankungen sind Krankheiten des Gehirns. Sie sollten von Betroffenen und Angehörigen als solche akzeptiert und ernst genommen werden. Menschen, die krankheitseinsichtig und behandlungswillig sind, haben bessere Chancen, gesund zu werden und zu bleiben. Wer ‚Profi seiner eigenen Krankheit‘ ist, kann auf eine günstigere Prognose hoffen. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte müssen dafür ausführlich aufklären, und zwar sowohl über die Krankheit selbst als auch über einzelne Schritte der Behandlung.«
Interview: Andrea Weber-Tuckermann
Foto: Nina Schnürrer
Illustration: Beniamino Raiola
