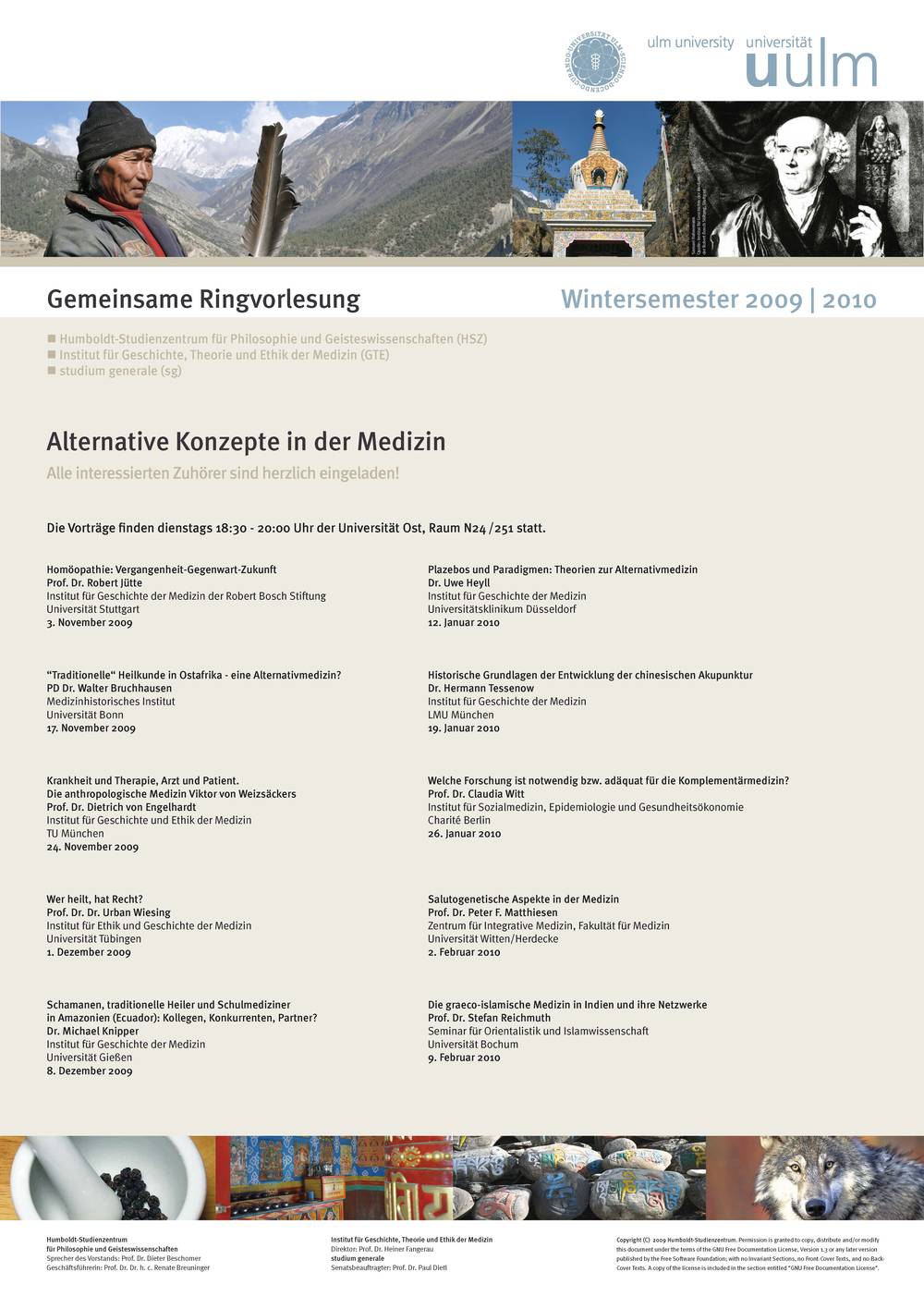Veranstaltungsarchiv
Tagungen und Workshops
Dienstag, 26. Mai 2015, 16:00 bis 20:00 Uhr
Villa Eberhardt
Heidenheimer Straße 80
89075 Ulm
Zum bereits dritten Mal wird am Dienstag nach Pfingsten aus heutiger medizinhistorischer Sicht der Frage nachgegangen, wie in Deutschland im „Zeitalter der Weltkriege“ und unmittelbar danach medizinisch-therapeutisch, aber auch sozialpolitisch und gesellschaftlich mit jenen verfahren wurde, die der Krieg gesundheitlich und körperlich oder geistig und seelisch massiv beeinträchtigt als „Versehrte“ entlassen hatte.
Die Veranstalter freuen sich, mit dieser Tagung die Fortsetzung zur letztjährigen Veranstaltung bieten zu dürfen und mögliche Impulse zu einer Reihe weiterer Ulmer Veranstaltungen zum Thema Nachkrieg und Medizin setzen zu können.
Veranstaltet von:
Vom 9.-11.10.2014 veranstaltet das Institut für Geschichte Theorie und Ethik der Medizin die Jahrestagung der Akademie für Ethik in der Medizin zu Themen, welche die Wirkungen des medizinisch-pflegerischen Technikeinsatzes im und am Menschen betreffen. Dabei geht es um grundlegende Fragen unseres Selbstverhältnisses als – Technik benutzende – Menschen ebenso, wie um konkrete Praxisanalysen. Damit ist das Ziel dieser Tagung sowohl eine neue systematische Auseinandersetzung mit Fragen der Technisierung unserer existentiellen Lebensbereiche als auch konkrete Hilfestellung in der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen, denen alle im medizinischen Bereich tätigen Personen ausgesetzt sind.
Die Tagung findet im Bereich des Neuen Hörsaals Chirurgie am Oberen Eselsberg statt (s. Lageplan)
11. und 12. September in der Villa Eberhardt in Ulm (Heidenheimer Straße 80)
Die heutige Populärkultur (auch: Popkultur) kann als eine der wichtigsten Kulturindustrien betrachtet werden, die starken Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung individueller Lebensentwürfe und Wissenswelten nimmt. Dabei bezieht sie sich in ihren visuellen und narrativen Darstellungen oft auch medizinisches Wissen und medikale Kulturen.
In der Tagung sollen medizinphilosophische, -theoretische, -historische und -praktische Manifestationen solcher Repräsentationen in Medien wie Filmen, Computerspielen, Comics oder auch ‚Schundliteratur‘ ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht werden. Hierzu stellen Forscher aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Südafrika und Rumänien den aktuellen Stand Ihrer Forschungen zu Visualisierungen und Repräsentationen von Medizin in der Popkultur vor.
Die Tagung ist öffentlich, um Anmeldung unter arno.goergen(at)uni-ulm.de (Tel. 0731 500-39914) wird gebeten.
Für die Tagung können 15 Fortbildungspunkte für das Fortbildungszertifikat der Landesärztekammer Baden-Württemberg erworben werden
Dienstag, 10. Juni 2014, 16.15 bis 19.45 Uhr
Villa Eberhardt
Heidenheimer Straße 80
89075 Ulm
Zum bereits zweiten Mal wird am Dienstag nach Pfingsten aus heutiger medizinhistorischer Sicht der Frage nachgegangen, wie in Deutschland im „Zeitalter der Weltkriege“ und unmittelbar danach medizinisch-therapeutisch, aber auch sozialpolitisch und gesellschaftlich mit jenen verfahren wurde, die der Krieg gesundheitlich und körperlich oder geistig und seelisch massiv beeinträchtigt als „Versehrte“ entlassen hatte. – Standen bei der ersten Ulmer Tagung „Nachkrieg und Medizin in Deutschland im 20. Jahrhundert“ im Mai 2013 vor allem die Patientensicht, die Selbstwahrnehmung der „Versehrten“, aber auch der gesellschaftliche Umgang mit ihnen, ebenso wie die Perspektive der sie behandelnden Mediziner im Fokus der Vorträge und Diskussionen, werden diesesmal vor allem die Behandlungsversuche verletzter und erkrankter Soldaten anhand von Krankenakten beleuchtet, ihr eigenes, teilweise extremes, deviantes Verhalten beschrieben sowie handelnde Gruppen von Ärzten kollektivbiographisch untersucht.
Die Veranstalter freuen sich, mit dieser Tagung die Fortsetzung zur letztjährigen, positiv aufgenommenen Tagungsidee bieten zu dürfen und mögliche Impulse zu einer Reihe weiterer Ulmer Veranstaltungen zum Thema Nachkrieg und Medizin setzen zu können.
Veranstaltet von:
*** Die o. g. Fortbildung wird mit 3 Fortbildungspunkten von der Landesärztekammer Baden-Württemberg auf das Fortbildungszertifikat anerkannt ***
24. - 25.05.2013
(Beginn am 24.05. um 14:00 Uhr c. t.)
Villa Eberhardt
Heidenheimer Straße 80
89075 Ulm
Kontakt und Anmeldung:
I. Polianski, C. Lenk
Tel.: 0731 500-39909
Fax: 0731 500-39902
<link fileadmin website_uni_ulm med.inst.085 flyer_anthropotechnik_2425__mai_2013.pdf download>Programm
Enhancement bedeutet in der biopolitischen und bioethischen Debatte den Versuch einer Verbesserung körperlicher oder geistiger Fähigkeiten über das „normale“ Maß hinaus. Ein solches Verständnis von Enhancement als „Steigerung“ oder „Verbesserung“ steckt bereits im Namen. Mit dieser Konnotation eröffnet das Thema Enhancement eine Vielzahl ebenso unbeantworteter wie ethisch umstrittener Fragen. Gleichwohl wurde es bislang hauptsächlich im engeren Referenzrahmen der Bioethik diskutiert und kaum in einen breiteren sozial- und kulturwissenschaftlichen Kontext gestellt. Zielsetzung des Workshops ist vor diesem Hintergrund der Austausch darüber, inwiefern aktuelle Techniken und Visionen der Steigerung menschlicher Fähigkeiten Kontinuitäten und Diskontinuitäten zu anderen medizinischen und nichtmedizinischen Steigerungs- und Verbesserungsmethoden sowie ihren jeweiligen funktionalen Äquivalenten und Vorläufern in der Geschichte aufweisen.
14.07.2013 - 20.07.2013
Villa Eberhardt, Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm
<link fileadmin website_uni_ulm med.inst.085 aal_flyer.pdf>Programm
Der demographische Wandel stellt die meisten europäischen Gesellschaften in den nächsten Jahrzehnten vor gravierende Herausforderungen. Immer mehr alte Menschen werden aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts immer länger leben und wollen dieses Leben möglichst selbstbestimmt in einem ihnen entsprechenden Lebensumfeld verbringen (Otten 2009; Dichgans 2011; BMFSJF 2010). Der zu erwartende höhere Pflegeaufwand wird jedoch nicht durch Pflegepersonal abgedeckt werden können; zum einen ist ein Fachkräftemangel schon jetzt spürbar; zum anderen wird dieser erhöhte Bedarf weder individuell noch gesellschaftlich finanzierbar sein.
Die sogenannte „Ambient-Assisted-Living“-Technologie (kurz: AAL) – die gleichfalls unter dem Begriff „altersgerechte Assistenzsysteme“ verhandelt wird – erscheint in dieser Situation als Ausweg, weil sie es älteren und alten Menschen erlauben soll, ihr Leben mit technischer Unterstützung weitgehend selbstbestimmt im eigenen Lebensumfeld zu verbringen (Georgieff 2008; Eichelberg 2010). Technische Assistenzsysteme werden überdies als kostengünstigere Variante gegenüber der stationären und personell aufwändigen Versorgung in Alten- und Pflegeheimen oder gegenüber einer personalintensiven Betreuung in den eigenen vier Wänden propagiert (Böhm et al. 2003; Wolf et al. 2010). Gleichfalls ist davon die Rede, dass AAL-Technik den Nutzern ein größeres Maß an Sicherheit, Unterstützung und gesellschaftlicher Teilhabe bieten könne (Kruse 1994; BMBF 2010).
Die Anwendungsbereiche dieser AAL-Systeme reichen von einfachen Schaltern für Licht, Heizung, Bügeleisen etc. bis hin zu Sensoren und Kameras zur Überwachung der häuslichen Aktivitäten von älteren und pflegebedürftigen Menschen, um etwa bei Stürzen oder längerer Passivität einen Notdienst zu alarmieren (Georgieff 2008). Komplexere Assistenzsysteme sollen Vitalparameter überwachen und sogar Vitalfunktionen steuern (Manzeschke 2009, 2011). Nicht zuletzt wird an Servicerobotern zur Substitution von Pflegekräften (z.B. zum Wenden bettlägeriger Menschen) sowie an Substituten für soziale, zwischenmenschliche Kontakte (z.B. die elektronische Robbe Paro) gearbeitet (Hülsken-Giesler 2008). Die anvisierten Lösungen sind dabei nicht als Einzellösungen zu verstehen, sondern als ein systemtechnologischer Ansatz, bei dem über Informations- und Kommunikationstechnologie alle Anwendungen vernetzt werden sollen (Manzeschke 2011).
Die sich aus der Entwicklung und dem Einsatz von altersgerechten Assistenzsystemen ergebenden Herausforderungen und Folgenabschätzungen sollen im Rahmen dieser Klausurwoche analysiert und diskutiert werden. Neben Vorträgen und Diskussionen mit geladenen Expertinnen und Experten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausurwoche Gelegenheit haben, ihre eigenen Forschungen vorzustellen.
Die Klausurwoche wird vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm (Prof. Dr. Heiner Fangerau, Debora Frommeld, M.A.) in Kooperation mit Herrn PD Dr. Arne Manzeschke und Herrn Prof. Dr. Karsten Weber sowie mit Unterstützung des Humboldt Studienzentrums und des Zentrums „Medizin und Gesellschaft“ der Universität Ulm ausgerichtet.
Kontakt:
Debora Frommeld, M.A.
Zentrum Medizin und Gesellschaft
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
Universität Ulm
Frauensteige 6
D-89075 Ulm
E-Mail: debora.frommeld@uni-ulm.de
Tel.: 0731 500 39916
URL: http://www.uni-ulm.de/zmg
Zitierte Literatur:
BMBF (2010) Selbstbestimmt leben. Mit Assistenzsystemen im Dienste des älteren Menschen, Berlin 2010.
BMFSFJ (2010) Altern im Wandel. Zentrale Ergebnisse des Deutschen Alterssurveys (DEAS), Publikationsversand der Bundesregierung, Berlin 2010.
Dichgans J (2011) Alter und Altern aus biologischer Perspektive. In: Gabriel K, Jäger W, Hoff GM (Hrsg.) Alter und Altern als Herausforderung, Alber, Freiburg/München, 21-48.
Böhm U, Röhrig A, Meyer S (2003): Telemonitoring und Smart Home Care – Akzeptanz, Vorbehalte und Nutzungsabsichten der Generation 50+. In: HealthAcademy 2, 148-165.
Eichelberg M (2010) Arbeitsgruppe „Schnittstellenintegration und Interoperabilität“ der BMBF/VDE Innovationspartnerschaft AAL: Interoperabilität von AALSystemkomponenten, VDE Verlag, Berlin.
Georgieff P (2008) Ambient Assisted Living.Marktpotenziale IT-unterstützter Pflege für ein selbstbestimmtes Altern, MFG Stiftung Baden-Württemberg, Stuttgart.
Hülsken-Giesler M (2008) Der Zugang zum Anderen. Zur theoretischen Rekonstruktion von Professionalisierungsstrategien pflegerischen Handelns im Spannungsfeld von Mimesis und Maschinenlogik, V&R Unipress, Osnabrück.
Kruse A (1994) Altersfreundliche Umwelten: Der Beitrag der Technik. In: Baltes PB, Mittelstraß J (Hrsg.) Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung, De Gruyter, Berlin, 668-694.
Manzeschke A: Ethische Aspekte von AAL – Ein Problemaufriss. In: Tagungsband 2. Deutscher AmbientAssisted Living Kongress, 27./28. 2. 2009, hrsg. vom VDE und
BMBF, Berlin/Offenbach (VDE-Verlag) 2009, 201–205.
Manzeschke A: »Tragen technische Assistenzen und Robotik zur Dehumanisierung der gesundheitlichen Versorgung bei? Ethische Skizzen für eine anstehende
Forschung. In: Brukamp K, Laryionava K, Schweikardt C, Groß D (Hrsg.): Technisierte Medizin – Dehumanisierte Medizin? Ethische, rechtliche, und soziale Aspekte neuer Medizintechnologien, Kassel University Press, Kassel 2011, 105–111.
Otten D (2009) Die 50+ Studie. Wie die jungen Alten die Gesellschaft revolutionieren, Rororo, Reinbek.
Wolf, B u.a.: Komponenten und Systeme für die personalisierte Assistenz. In: Niederlag W, Lemke HU, Golubnitschaja O, Rienhoff O (Hrsg.), Personalisierte Medizin, Health-Academy 14, Dresden 2010, 215– 234.

Ausstellungseröffnung „‘Fegt alle hinweg, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen wollen!‘, Ausstellung zum Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte 1938“ und Vorstellung der Broschüre „Ulmer jüdische Ärzte im Nationalsozialismus“
Im Rahmen der Veranstaltungen zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 und die Opfer des Nationalsozialismus eröffnen das Haus der Stadtgeschichte der Stadt Ulm, sowie das Zentrum Medizin und Gesellschaft und das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Universität Ulm)mit freundlicher Förderung der Landesärztekammer Baden-Württemberg am 09. November 2012 um 20 Uhr im Schwörhaus die Ausstellung „Fegt alle hinweg, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen wollen!“ Ausstellung zum Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte 1938“. Im gleichen Rahmen wird die Broschüre „Ulmer jüdische Ärzte im Nationalsozialismus“ vorgestellt.
Die Veranstaltung erfolgt im Anschluss an die um 19 Uhr beginnende Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung und Vertreibung der Ulmer Juden im Nationalsozialismus auf dem Weinhof (Organisation: Deutsch-Israelitische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm, Schirmherr: OB Ivo Gönner)
Die Ausstellung wurde ursprünglich 2008 für München zum 70. Jahrestag des Approbationsentzuges konzipiert und wurde mittlerweile wurde sie unter regem öffentlichem Interesse an 27 Orten gezeigt. Schwerpunktmäßig beleuchtet die Ausstellung die Schicksale jüdischer Ärzte während der Zeit des Nationalsozialismus in Bayern. 2011 erhielt das Ausstellungsprojekt einen Sonderpreis des Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für wissenschaftliche Arbeiten „Zur Rolle der Ärzteschaft in der Zeit des Nationalsozialismus“. In Ulm wird die Ausstellung vom 09. November bis zum 15. Dezember jeweils von Dienstag bis Samstag von 11-17 Uhr zu sehen sein.
Die Broschüre „Ulmer jüdische Ärzte im Nationalsozialismus“ wirft im Rahmen der Ausstellung einen Blick auf die vielfältigen Schicksale der jüdischen Ärzte und Zahnärzte, die in Ulm praktizierten. Während manche Schicksale schon bekannt sind (Paul Neuhaus, Paul Moos, Sigmar Ury und Ludwig Hecht), konnten auch weitere Ärzte ermittelt werden, über die man nur wenig an Informationen ermitteln konnte (Joachim Blumenthal, Paul Erlanger, Martin Glück, Ernst Wolf). Somit versteht sich die Broschüre auch als Aufruf, mögliches Wissen, Erinnerungen oder Memorabilia an die Ärzte mit den veranstaltenden Personen zu teilen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Haus der Geschichte/Stadtarchiv (0731/161-4200), oder das Zentrum Medizin und Gesellschaft der Universität Ulm (0731/500-39901). Für weitere Informationen zur Ausstellung besuchen Sie bitte im Internet die Seite http://www.jahrestag-approbationsentzug.de/.
Beginn: 14.06.2012
Ende: 16.06.2012
Veranstaltungsort: Villa Eberhardt, Heidenheimer Straße 80, D- 89075 Ulm
Mit freundlicher Förderung der GERDA HENKEL STIFTUNG
Bilder vom Ungeborenen werden zu den überzeugungsstärksten visuellen Phänomenen unserer Kultur gezählt. Die Tagung „Visualisierung des Ungeborenen. Historische, ästhetische, ethische, medizinische und rechtliche Dimensionen“ beleuchtet die Bedingungen der vermeintlichen Authentifizierungskraft pränataler Bilderwelten. Damit flankiert die Tagung Fragen nach dem historischen und aktuellen Status des visualisierten Ungeborenen in Medizin, Medizingeschichte, Medizinethik, Psychologie, Bildwissenschaft, Rechtswissenschaft und Theologie. Mit der Verknüpfung dieser Fachbereiche will die Tagung einen möglichst breit fundierten Beitrag zur derzeit intensivierten Debatte um den Lebensbeginn des Menschen liefern – und das Denken über Bilder von Ungeborenen aus interdisziplinärer Perspektive differenzieren.
Vorträge von folgenden Referenten:
Prof. Dr. Rainer Anselm, Prof. Dr. Rolf Becker, Prof. Dr. Cornelius Borck, Prof. Dr. Barbara Duden, Prof. Dr. Gunnar Duttge, Prof. Dr. Marcus Düwell, Prof. Dr. Heribert Kentenich, Prof. Dr. Verena Krieger, Prof. Dr. Christian Kubisch, Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber, PD Dr. Arne Manzeschke, Prof. Dr. em. Irmgard Müller, Prof. Dr. Ortrun Riha, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Prof. Dr. Michael Stolberg, Sven Stollfuß M.A., Prof. Dr. Christiane Woopen
Veranstalter:
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Institut für Kunstwissenschaft und Medientheorie, Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe
Zentrum Medizin und Gesellschaft, Universität Ulm
Teilnahmegebühr:
20,-- Euro pro Person; Studierende können kostenfrei teilnehmen.
Die Veranstaltung ist von der Landesärztekammer Baden-Württemberg mit 17 Punkten zertifiziert.
Hier können Sie das <link fileadmin website_uni_ulm med.inst.085 flyer_visualisierung_stand_30-05-2012_neu2.pdf download>Programm herunterladen.
Um Anmeldung wird gebeten bis 01.06.2012 an med.gte(at)uni-ulm.de oder per Fax: 0731 500-39902.
Im Zuge aktueller Entwicklungen wie etwa der weltweiten Mobilität medizinischen Personals und seiner Klientel, der Kommodifizierung kulturell gebundener medizinischer Konzepte und der zunehmenden Bedeutung biodiversitätsspezifischer, DNA-basierter Medizin gewinnen Fragen von weltweiter medizinischer Versorgung, Forschung und Gesundheitspolitik zunehmend an Gewicht. Gerade auch von studentischer Seite und von Seiten der Hochschullehrer besteht ein wachsendes, empirisch belegbares Interesse an der Vermittlung von Aspekten der globalen Gesundheitsversorgung. Indizien dafür sind dezidierte Bedarfsanalysen von studentischer Seite bezüglich des Ist-Zustandes und des Ausbildungsbedarfs im Global Health-Bereich, die Gründung einer bundesdeutschen Global Health Allianz im Mai 2011 an der Universität Marburg, die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Nachwuchsförderung im Bereich „Globale Gesundheit“ durch die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit (DTG) und die Einrichtung eines Panels Teaching Global Health in Medical Training auf dem europäischen Kongress für Tropenmedizin und International Health in Barcelona im Oktober 2011.
Vor diesem Hintergrund fand vom 16.-29. Juli 2012 unter dem Thema Perspectives on Global Health in the 21st Century - Medical Tourism eine vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) mit Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesregierung geförderte Sommerakademie in der Villa Eberhardt, einem der Tagungszentren der Universität Ulm statt.
Den Ausgangspunkt dieser Lehr- und Studienveranstaltung bildete die weltweite Auslagerung von Heil- und Pflegeleistungen im Sinne eines Global Outsourcing, indem einerseits gezielt Angebote von technisch und fachlich aufwändigen Heil- und Pflegeleistungen in westlichen Ländern (USA, Westeuropa, Japan) für eine Klientel aus der südlichen Erdhälfte bereit gestellt werden, andererseits vergleichsweise kostengünstige Dienstleistungen in Bezug auf Alten- und Krankenversorgung (einschließlich von Rehabilitationsmaßnahmen und medizinischer Langzeitbetreuung) mit westlichem Standard in der der südlichen Erdhälfte auf dem inzwischen globalisierten Gesundheitsmarkt angeboten werden.
Das Hauptaugenmerk der Sommerakademie lag auf der gegenseitigen Konfrontation verschiedener Medizinkonzepte und dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher kultur- und geschichtsdependenter medizinischer Vorstellungen, weniger auf der organisatorisch-technischen „Abwicklung“ medizintouristischer Transferleistungen. Ziel war es, transkulturelle Facetten des Medizintourismus in einer multidisziplinären Perspektive zu beleuchten und zu einer ethisch begründeten Bewertung beizutragen. Eingebunden war das Programm dieser Veranstaltung damit in aktuelle medizintheoretische Debatten um transkulturelle Aspekte von Therapie- und Pflegeleistungen, gerade auch in Folge internationaler Migrationsbewegungen. Die bisherige Literaturauswertung zeigte, dass eine derartig facettenreiche Illustration der mit dem Terminus „Medizintourismus“ umschriebenen Phänomene noch nicht geleistet worden war.
Tagungsbericht
Kurze Darstellung der Lernziele
(1) Medizintourismus – Ermittlung des Ist-Zustandes (State of the Art)
Der Bestandsaufnahme von aktuellen Formen und Erscheinungsweise dienten die Präsentationen in den Participants‘ Panels zu Medical travel – country Based Reviews: Examples from the Americas, Africa und Asia sowie eine Exkursion in die PanKlinik nach Köln, die sich auf Medizintouristen aus den ehemaligen GUS-Staaten und dem arabisch-sprachigen Raum spezialisiert hat. Die “Bestandsaufnahmen” bestanden in den folgenden Präsentationen: Panoramas and Prospects of the Development of Health Tourism in Recife - Pernambuco (Edrienny Patricia Accioly), India – A Hub for Travel Medical with Entertainment (Pardip S. Shehrawat), Medical Tourism – A new Concept in Zambia (Evans Tembo) sowie Diagnosis of Current Medical Tourism Industries in Korea and its Future Directions (Lee Yunjeong).
(2) Medizintourismus – eine erweiterte Definition
In der Sommerakademie wurde in multiperspektivischer und fächerübergreifender Weise das Augenmerk darauf gerichtet, dass in Erweiterung des landläufigen Verständnisses „Medizintourismus“ in die weltweite Vernetzung von Gesundheitsbedürfnissen und Gesundheitsleistungen unter historischen, ethnologischen, medizinischen, soziologischen, politischen und ökonomischen Vorzeichen eingebunden ist.
Exemplarisch wurde der Transfer medizinischer Leistungen und Konzepte in den Präsentationen von Asad Ashour (‘Rugya Sharia‘– Ritual medication and its Use in Palestine), Amina Ather (Alternate Medicine Units for Medical Tourism in India), Claudia Preckel (Making Unani Medicine a Western Style Therapy?), Winfried Pfeffer (A Survey of Tibetan Medicine) und Arpit Gupta (Dental Tourism – A Big Opportunity – mit Bezug auf Indien) dargestellt und damit das Augenmerk auf
- die Inanspruchnahme westlicher Formen der Diagnose und Therapie in bislang eher peripheren Regionen biomedizinischer Versorgung,
- die Inanspruchnahme westlicher Formen der Diagnose und Therapie in etablierten Zentren der biomedizinischen Versorgung (Nordamerika, Westeuropa, Japan) durch Patienten aus Transformations- und Schwellenländern und/ oder peripheren Regionen der südlichen Erdhälfte,
- und die Inanspruchnahme nicht-westlicher Formen der Diagnose und Therapie durch Patienten europäisch/euroamerikanischen Hintergrunds in den bisherigen Zentren biomedizinischer Versorgung (etwa Transfer von tibetischer Medizin in den Westen) wie auch in Regionen weit gefächerter, nicht westlicher ethnomedizinischer Traditionen gerichtet.
(3) Die transkulturelle Begegnung verschiedener Medizinkonzepte – Ritual und Heilung
Gemäß dem Fokus der Sommerakademie, der mehr auf der gegenseitigen Konfrontation verschiedener Medizinkonzepte und dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher kultur- und geschichtsdependenter medizinischer Vorstellungen als auf der organisatorisch-technischen „Abwicklung“ medizintouristischer Transferleistungen lag, wurden transkulturelle Facetten des Medizintourismus in einer multidisziplinären Perspektive beleuchtet. Diesem Ziel dienten die einleitenden Präsentationen der Ethnomediziner Michael Knipper und Frank Kressing (Health Shopping, Healer Shopping, ‘Paradigm Shopping‘ – Examples from the Amazon and Ladakh) sowie von Michael Knipper (Examples of Transcultural Transfer of Curing and Healing: Radiografía con el cuy and other Examples from Latin America) und der Ethnologin Lena Kroeker (Western ‘Biomedicine‘ and ‘Traditional‘ Ethnomedicine – a Review of Concepts and Definitions).
Das Programm der Veranstaltung war somit eingebunden in aktuelle medizintheoretische Debatten um transkulturelle Aspekte von Therapie- und Pflegeleistungen, gerade auch in Folge internationaler Migrationsbewegungen, wobei sich in den Diskussionen mit Teilnehmern ganz verschiedenen religiösen Hintergrunds (Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus) und z.T. einschlägiger ethnographischer Feldforschungserfahrung herausstellte, dass traditionelle Heilweisen so gut wie immer in den spirituell begründeten Komplex von Ritual und Heilung eingebunden sind und die westliche Medizinkultur nur eine von vielen weltweit verbreiteten Medizinkulturen darstellt. Weiterhin bestand Einigkeit darin, dass sich eine historisch gewachsene, z.T. transkulturell orientierte Grundlage des Medizintourismus im traditionellen Pilgerwesen des christlichen Europa, islamischen Orient, hinduistischen und buddhistischen Asien wie auch in indigenen Kulturen finden lässt – im Pilgerwesen, das sowohl der Suche nach spirituellem als durchaus auch nach körperlichem Heil gewidmet war und ist.
(4) Ethische begründete Bewertung globalisierter medizinischer Versorgung
Medizintourismus als Benefit or Burden – dies stellte sich als zentrale Fragestellung in Bezug auf die ethische Bewertung globalisierter medizinischer Kommodifizierung von Versorgungseinrichtungen, natürlichen Ressourcen, medizinischen und paramedizinischen Personals und letztendlich sogar von menschlichen Organen heraus.
Näher beleuchtet wurde diese Fragestellung in den Beiträgen von Debora Frommeld (Ideals of Human Beauty and Wellness in History) und Sebastian Kessler (Brain Drain – Brain Gain: Aspects and Results of Labor Migration in Medical Practioners) sowie von Sonia-Elena Popovici (Globalized Organ Transplant: Meeting Health Needs or Altering Populations?) und Noranjon Ayombekova (Medical Tourism in the Pamir Mts./Gorno-Badakhshan) sowie – in einer linguistisch-semantischen Analyse – von Merle Michaelsen (Medical Treatment or a Big Business? An Ethical Analysis of the Tourism Metaphor in the Scholarly Discourse).
(5) Historische Grundlagen medizinischen „Grenzgängertums“
Das Lernziel bestand hier in der Schärfung des Bewusstseins, dass die Kritik an der westlichen Biomedizin und Hinwendung zu außereuropäischer Alternativ-, Komplementär- und Ethnomedizin weit zurückliegende historische Grundlagen aufweist. Dazu stellte Heiner Fangerau Grundlagen der Lebensreformbewegung des 19. Jahrhunderts dar, die bereits zu einer Zeit, als die Biomedizin einen nur sehr unvollständigen Entwicklungsstand erreicht hatte, Kritik am westlichen Medizinsystem übte und nach Alternativen suchte, z.B. im inzwischen traditionellen Kur- und Badetourismus, verbunden mit der wissenschaftlich untermauerten Balneologie (Early Critique of Western Medicine: ‘Life Reform Movements‘).
Vertieft wurde die Beschäftigung mit spezifisch deutsch-sprachigen Traditionen der Komplementär- und Alternativmedizin beim Besuch des Robert-Bosch-Instituts für Medizingeschichte in Stuttgart, bei dem Robert Jütte und Hans Dinges einen Überblick über die Entwicklung der Homöopathie und der anthroposophischen Medizin gaben.
(6) Aspekte der Entgrenzung von Medizin als Folge von Medizintourismus und dessen Einbindung in globale ökonomische Referenzsysteme
Die mangelnde Möglichkeit der Überprüfung, empirischen Verifizierung und Lizensierung von Heilverfahren, die unreflektierte Idealisierung des Fremden im postkolonialen interkultureller Diskurs und die unreflektierte Übernahme missverstandener oder nur partiell zugänglicher spiritueller Traditionen in westliche Ökonomisierungsmechanismen wurden in der Participants‘ session „A Critical Appraisal of Medical Travel and Palliative Care for Foreigners“ thematisiert. In diesem Teil der Veranstaltung kamen auch gesundheits-ökonomische Aspekte der Kostenminimierung durch „Therapieauslagerung“ und der Substitution von Pflegeleistungen bis hin zu Aspekten eines „Sterbetourismus“ als spirituell begleiteter ökonomisch erschwinglicher Betreuung in der Endphase des Lebens zur Sprache.
Im Einzelnen handelte es sich dabei um die Beiträge Globalized Organ Transplant: Meeting Health Needs or Altering Populations? (Sonia-Elena Popovici), Untreated Pain: A Situational Analysis of Palliative Care Services in India (Pooja Sharma), Dental Tourism – A Big Opportunity (Arpit Gupta) und Medical Treatment or a Big Business? An Ethical Analysis of the Tourism Metaphor in the Scholarly Discourse von Merle Michaelsen.
Integration der Sommerakademie in das Lehrangebot der Universität Ulm
Das Thema der Sommerakademie ist einerseits durch das Wahlpflichtfach “Global Health” in das Curriculum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin integriert, andererseits durch das Programm zur nachhaltigen Internationalisierung der akademischen Lehre in das Projekt UULM PRO MINT & MED (Universität Ulm, Universitätsklinikum Ulm, Bundesminsterium der Verteidigung, Verbundantrag PiCS@Uulm – Practical and Communication Skills Concept - UULM PRO MINT & MED. Ulm, 29.07.2011, S. 18-19).
Angestrebte Zielgruppe
Als Klientel der Sommerakademien waren Nachwuchswissenschaftler, Studierende der Medizin sowie der Lebens- und Biowissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaften, Ethnologie/Kulturanthropologie, Kultur- und Medizingeschichte, Wirtschafts-, Medien- und Kommunikations-wissenschaften vorgesehen, vorzugsweise aus Ländern des Nahen Ostens, postsozialistischen Transformationsländern und der südlichen Erdhälfte. Die 14 Teilnehmern und Teilnehmerinnen kamen aus folgenden Bereichen: Bioethik, Public Health, Biomedical Engineering, Krankenpflege (Master Nursing Program der Universität Recife/Bahia), Humanitäre Organisationen (z.B. Norwegian Refugee Council), pharmazeutische Forschung, Zahnheilkunde, Informationstechnologie, Gesundheitsmanagements, Medizingeschichte, Psychologie, Soziologie, Kulturanthropologie, Landwirtschaft und Gesundheitsadministration, so dass ein breit gefächertes Spektrum der Fortbildungsveranstaltungen mit dem Ziel der interdisziplinaren Vernetzung von Natur-, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften gewährleistet war.
Mit einer Teilnehmerin aus Südamerika, zwei Teilnehmern aus dem subsaharen Afrika und sechs Teilnehmern aus Südasien (Indien, Sri Lanka, Pakistan) stammte die Mehrheit der Klientel aus der südlichen Erdhälfte. Zwei Teilnehmer stammten aus Vorder- und Zentralasien (Palästina, Tadschikistan), zwei aus postsozialistischen Transformationsländern (Rumänien, Tadschikistan).
Werbemaßnahmen
Zur Werbung für die Sommerakademie wurden im Vorfeld gezielt folgende Institutionen um Unterstützung gebeten:
- International Office der Universität Ulm, Leiter: Dr. Reinhold Lücker. Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm, Tel. 0731-50-22014
- Fachforum H-Soz-Kult (Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften) der Humboldt-Universität Berlin, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
- International Human and Social Net Online (H-Sci-Tech-Med)
- German University in Cairo, New Cairo City, Main Entrance El Tagamoa El Khames, Hotline: 16482, Tel: 00202 27589990-8, Fax: 00202 27581041
- ArabMed-AG der Charité in Berlin c/o Mamon Dweek, mamon.dweek(at)charite.de, Mobil: 0176-64290015; http://www.fsi-charite.de/wb/pages/ags/arabmed-ag.php
- Arabian German Medical Alumni Network (AGMAN) an der Universität Erlangen-Nürnberg
- Global Health Alliance c/o Globalisation and Health Initiative (GandHI), Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd), Kennedyallee 91–103, 53175 Bonn , Tel. 0228-882–731, Fax 0228-882–732, bvmd.de
- Istanbul Health Museum EU Project
- Harvard Initiative for Global Health, 104 Mt. Auburn Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02138, USA, Tel. 001-617-495-8222, Fax: 001-617-495-8231, globalhealth(at)harvard.edu
- John Hopkins Center for Global Health, Hampton House 180, 624 N. Broadway, Baltimore, MD 21205, USA, www.hopkinsglobalhealth.org, Direktor: Thomas Quinn, MD, MSc, Tel. 001-410-955-7635, tquinn2(at)jhmi.edu
Darüber hinaus wurde der Flyer an insgesamt 700 Adressen im In- und Ausland versandt. Flyer.pdf
Zulassungsvoraussetzungen
Es galten folgende Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an der Sommerakademie:
- Für Studierende der Medizin: Physikum oder vergleichbare Leistung
- Für Studierende anderer Fachrichtungen: B.A., M.A. oder vergleichbarer Abschluß
- Für Nachwuchswissenschaftler: Nachweis des Studienabschlusses und der vorherigen Beschäftigung mit einem Thema aus dem Global Health- Bereich.
Auswahlverfahren
Auswahlkriterien waren:
- Qualität des Abstracts für den Vortrag
- Nachgewiesene Expertise im Bereich Public Health/ Gesundheitsmanagement/ Ethnomedizin
- Qualität der akademischen Abschlüsse
- Nachweisbare Ernsthaftigkeit der Teilnahmeabsicht an der Sommerakademie
Kulturelles Begleitprogramm
Das kulturelle Begleitprogramm umfasste:
- Stadtführung durch das Ulmer Fischer- und Gerberviertel und das Münster
- Exkursion in die PanKlinik – Besuch des Kölner Doms
- Besuch des Tibet-Hauses in Freiburg – des Freiburger Münsters, der Freiburger Altstadt und der Altstadt von Basel
- Exkursion nach Heidelberg – Besuch des Deutschen Apothekenmuseums, des Heidelberger Schlosses und der dortigen Altstadt
- Teilnahme am Schwörmontag in Ulm und am „Nabada“ (Ulmer Wasserkarneval)
- Exkursion in das Institut für Medizingeschichte der Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart – Besichtigung der Stuttgarter Innenstadt (Schlosspark, Rosensteinpark)
- Exkursion nach Ingolstadt – Besuch des Deutschen Medizinhistorischen Museums, der Altstadt (Gründungshaus der Illuminaten) – Fahrt nach München
- Exkursion nach Blaubeuren (Karstquelle „Blautopf“, eh. Benediktinerkloster mit Hochaltar, Altstadt und Schwäbische Alb)
Logistische Unterstützung
Nachhaltige logistische Unterstützung während der Sommerakademie wurde sowohl vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (GTE) als auch vom Zentrum für Medizin und Gesellschaft, insbesondere von Herrn Sebastian Kessler M.A., Frau Debora Frommeld M.A., Herrn Arno Görgen M.A. und Frau stud. Johanna Schwerdtle, Hochschule Neu-Ulm, geleistet.
Medienarbeit
Ein Rundfunkinterview (Prof. Dr. Heiner Fangerau, Dr. Frank Kressing) wurde während der Sommerakademie mit Frau Anita Schlesak, SWR Ulm geführt (s. Anlage).
Publikationen
Kressing, F (2012) Bericht über die Internationale Sommerakademie "Perspectives on Global Health in the 21st Century – Medical Tourism", 16.–29.07.2012, Universität Ulm. Curare – Zeitschrift for Medizinethnologie, Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM), 35/4 (2012), 280–283.
May 21-22, 2010, Villa Eberhardt, Ulm, Germany
Imaging plays a prominent role in contemporary medical research and practice. This conference will focus on three related aspects of imaging the human body, demonstrating a range of cultural, historical and scientific concerns:
- Scientific representations
- Ontologies
- Ethics
It is the aim of the conference to reconstruct methods of diagnostic knowledge and their social, anthropological and technological origins and future implications. Among the topics to be discussed are:
- the production of knowledge using imaging techniques, and the commensurability of that knowledge across imaging modalities;
- experimental systems and the role of data and data collection for medical diagnosis and communication;
- the role of formal ontologies in representation and communication with medical images;
- norms of health and disease and the understanding of body (and mind) as they are shaped by imaging technologies;
- the interdependence of technology, medicine, economics and engineering.
This wide-ranging conference will include plenary lectures from eminent scholars in the field, panel seminars, author-meets-critics sessions, outreach activities, and social receptions.
Individual papers are invited in all areas concerned with Medical Imaging and Philosophy: Challenges, Reflections and Actions=94, broadly construed.
Proposed submissions for papers should outline the interdisciplinary dimensions and perspectives of the above mentioned connections between scientific representations, ontologies and ethics.
Submissions should include an abstract (max. 250 words) and full contact details of the presenting author. A submissions should be sent, preferably in MS Word or plain text format, to Heiner Fangerau.
Abstract Deadline: February 1st
Scientific Committee: Heiner Fangerau (Ulm University), Rethy K. Chhem (Ulm University), Irmgard Müller (Bochum), Santiago Sia (Milltown Institute, Dublin), Cesare Romagnoli (University of Western Ontario), James Overton (University of Western Ontario), Robert Lindenberg (Harvard Medical School, Boston), Shih-chang (Ming) Wang (University of Sydney)
Die Veranstaltung wird mit 12 Fortbildungspunkten (Kategorie B) von derLandesärztekammer Baden-Württemberg zur Erlangung desFortbildungszertifikates anerkannt. Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
For application and / or further information please contact:
Sebastian Kessler
Programme
An interdisciplinary Workshop, 11.-12.06.2009, Duesseldorf, Germany
Schloss Mickeln Conference Center of
Heinrich-Heine-University Duesseldorf
Alt Himmelgeist 25
40589 Düsseldorf
Organized by the BMBF-Studygroup "Evolution and Classification in Biology, Linguistics and the History of Science" (Prof. Dr. Heiner Fangerau, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm, Prof. Dr. Hans Geisler, Lehrstuhl Romanistik II, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Prof. William Martin, Institut für Botanik III, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, project coordinator: Thorsten Halling, M.A., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm)
Genome evolution, language evolution and the evolution of knowledge have much in common. They entail evolving elements - genes, words, ideas - that are mostly inherited in a vertical manner from ancestors to descendents, but sometimes are inherited laterally. The present transdisciplinary project aims to study the evolutionary dynamics of science, languages and genomes using methods from the field of molecular evolution and incorporating network methods. Current applications for phylogenetic reconstruction operate mostly in the realm of bifurcating phylogenetic trees, which are used to model acquisition by inheritance only. However, genes in microbial genomes can also be
acquired laterally, while words can be borrowed between different languages and knowledge can be transferred across disciplinary or cultural boundaries. Phylogenetic trees cannot easily be used to model such lateral transfers, but network approaches can.
On this conference theoretical and methodical aspects on the network approaches and first results from the workgroups will be presented and discussed.
Program:
Thursday, 11.06.2009
14:00 Introduction and welcome
First Section: History & Philosophy
14:30 Maureen O'Malley (Exeter): Philosophy and the Tree of Life
15:15 Simone Roggenbuck (Aachen): "Metaphors we live by". Visual
metaphors in linguistics
16:00 Coffee Break
16:15 Matthis Krischel (Ulm): Similar and Distinct Patterns in Biological and Cultural Development: An Answer to Gray, Greenhill & Ross
17:00 Tanya Kelley (University of Kansas): How the capacity for categorization
affects human language
17:45 Fiona Jordan (Nijmegen): Cultural evolution
18:30 Frank Kressing (Ulm): Combining phylogenetic trees of human languages and populations - preliminary remarks on 19th/ 20th centuries attempts
19:30 Dinner
Friday, 12.06.2009
Second Section: Languages
09:00 Michael Dunn (Nijmegen): The evolution of language structures
09:45 Sven Sommerfeld (Duesseldorf): New databases for historical linguistics: getting rid of cognate judgements?
10:30 Coffee Break
10:45 Søren Wichmann (Leipzig): Elbow effects: a universal feature of language taxonomics
11:30 Johann-Mattis List (Duesseldorf): How basic is basic vocabulary? The problematic case of Bai
Third Section: Biology
12:15 Eric Bapteste (Paris): Why network should help studying microbial evolution
13:00 Lunch
14:30 Shijulal NS, William Martin, Tal Dagan (Duesseldorf): A network approach to study vertical inheritance and lateral transfer during the evolution of Indo-European languages
15:15 Ovidiu Popa, Giddy Landan, William Martin, Tal Dagan (Duesseldorf): A reconstructed network of detectable lateral gene transfers in prokaryotes reveals barriers for transfer between different taxonomic groups
16:00 Coffee Break
16:15-16:45 Final Discussion
June 24th-26th, 2011, Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg, Universität Ulm
Bridging Disciplines: Evolution and Classification in Biology, Linguistics and the History of Sciences (conference report; program; abstract; press release)
Wintersemester 2010/2011
Beginn: 07. Oktober 2010, 17:30 Uhr
Ort: Lichthof des Ulmer Museums
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte der Universitätskliniken Ulm und der Umgebung
Die Veranstaltung (Kategorie A) wird mit 16 Punkten von der Landesärztekammer Baden-Württemberg auf das Fortbildungszertifikat anerkannt.
July, 2nd/3rd, 2010, Villa Eberhardt, Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm
It is assumed that tree models played a predominant role in theories of evolution of biological diversity and languages from the 18th century onwards. In the history of science, it has often been overlooked and neglected that concomitantly with the development of evolutionary theories, the idea of vertical transfer between languages, cultures, and, to a limited extent, between different species in biology, was developed, providing an alternative to the dominant pedigree model of human development. Based on empirical studies, the workshop will highlight theories and models of lateral transfer in biology, anthropology and linguistics. Papers submitted to the workshop are expected to consider historical developments by applying network models, with a special focus on personal, institutional and intellectual reticulation. Furthermore, papers on mutual interferences between the scientific disciplines are invited.
A publication of the contributions is planned.
For further information please contact:
Thorsten Halling
programme & CFP
Öffentliche Kolloquien
Beginn: 10:30 Uhr
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
3. Stock (Zi. 301)
Parkstraße 11
89073 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
DatumReferentThema
| 28.10.2015 | PD Dr. Ferdinand Peter Moog Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Uniklinik Köln | Gladiatoren im Spiegel der Medizin- und Kulturgeschichte. |
| 25.11.2015 | Dr. Gerd Zillhardt Ulm | Die Bedeutung des Arztes Heinrich Steinhövel für die Planung des Chorgestühls im Ulmer Münster. |
| 02.12.2015 | Dr. Felicitas Söhner Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm | Darstellung und Wahrnehmung des Patienten in medizinischen Aufzeichnungsverfahren - zu psychiatrischen Kankenakten sogenannter "Ostarbeiter". |
| 20.01.2016 | Prof. Riccardo Nicolosi | Degeneration als Erzählmodell. Psychiatrie und Literatur im Russland der späten Zarenzeit. |
| 02.03.2016 | Prof. Dr. Udo X. Kaisers Leitender Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Ulm | End of Life. |
| 24.02.2016 | Dr. Marco Stier Universität Münster | Die Biologische Psychiatrie und der Vorwurf des Kategorienfehlers. |
| 16.03.2016 | Anna Urbach Otto von Guericke Universität Magdeburg | Anfallsdokumentation bei Epilepsiepatienten um 1900. |
Die Vorträge am 24.02. und 16.03.2016 müssen leider Entfallen.
Wir bitten um Verständnis.
Beginn: 10:15 Uhr
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm
Frauensteige 6 (Haus 5833, Michelsberg)
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum Referent Thema
| 29.04. | Dr. Richard Kühl | Wo ist Sauerbruch? Über das Verschwinden "großer" Ärzte in der deutschen Medizinhistoriographie. |
| 06.05. | Georg Brenner Universität Ulm | Strukturelle Untersuchungen zu einem komplexen chirurgischen Text des ausgehenden Mittelalters |
| 27.05. | Lea Schumacher GTE Ulm | NEEDS in ALS |
| 03.06. | Dr. Mathias Witt | Die Chirugie des griechisch-römischen Altertums - von Kos nach Alexandrien und in die arabische Welt. |
| 17.06. | Dr. Sascha Topp Universität Gießen | Exkulpation und Apologie, Selbstreflexionen der deutschen Medizin nach dem Holocaust |
Beginn: 10:15 Uhr
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm
Frauensteige 6 (Haus 5833, Michelsberg)
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
19.11. | Prof. Dr. Nils Hoppe (Centre for Ethics and Law in the Life Sciences der Universität Hannover) | Tierexperimentelle Forschung: Einflüsse öffentlicher Wahrnehmung auf die Regulierung
|
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm
Frauensteige 6 (Haus 5833, Michelsberg)
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
23.04. | Dr. Christoph Schickhardt (Uni Bamberg) | Ethische und metaethische Überlegungen zum Begriff des Kindeswohls |
21.05. | Michael Eckerl (Uni Ulm) | Legitimierungsstrategien der deutschsprachigen Medizingeschichte im 20. und 21. Jahrhundert |
04.06. | Prof. Dr. Jürgen Aschoff (Uni Ulm) | Wer darf in Deutschland welche Patienten behandeln? Wann, womit, in welchem Umfang |
18.06. | Dr. Oxana Kosenko (Sächsische Akademie der Wissenschaften) | Zelluläre und humorale Immunitätslehren um 1900: Denkkollektive und Wissenskommunikation |
09.07. | PD Dr. Hans-Jörg Ehni (Uni Tübingen) | Sieben Thesen zur Zukunft des Alter(n)s und der Medizin |
16.07. | Prof. Dr. Klaus Schepker (Uni Ulm) | Die Frühgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Kontinuitäten und Diskontinuitäten
Achtung: Findet statt im Kursraum II in der Klinik Michelsberg |
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm
Frauensteige 6 (Haus 5833, Michelsberg)
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
DatumReferentThema
| 30.10. | Prof. Dr. Florian Mildenberger (Berlin) | Kontaminiertes Erbe - der Streit um die Rettung und Ordnung des Nachlasses des Medizinhistoriker-Ehepaars Artelt/Heischkel-Artelt |
| 20.11. | Sebastian Kessler (Ulm) | Ungleichheiten in der Gesundheit. Eine von der wissenssoziologischen Diskursanalyse inspirierte Begriffsgeschichte |
| 27.11. | Sonia Popovici (University Timisoara, Romania) | Globalized Organ Transplant: Meeting Health Needs or Altering Populations? [Sonia Elena Popovici, Victor Babe] |
| 11.12. | Dr. Nils Hansson (Uni Göttingen) | Nobel Prize Nominations of and by Cutting-edge-Surgeons 1901-1951 |
| 08.01. | Dr. Florian Bruns (Charité Berlin) | "...daß uns die Partei der Arbeiterklasse nicht im Stich läßt." Patienten und ihre Eingaben im letzten Jahrzehnt der DDR. |
| 26.02. | Prof. Dr. Jürgen Aschoff (Uni Ulm) | Quecksilber - Ideen zum Quecksilbergebrauch als Medizin in westlicher versus östlicher Vorstellun |
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm
Frauensteige 6 (Haus 5833, Michelsberg)
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
DatumReferentThema
| 24.04. | Nina Kleinöder (Uni Düsseldorf) | Arbeitsschutz und Betriebsärzte in der Schwerindustrie 1930-1970 |
| 29.05. | Jacob Tomala (Uni Ulm) | 8 Elemente der Basisgesundheitsversorgung - Global Health Hier & Dort |
| 05.06. | Anna Jakovljevic (Uni Göttingen) | Einwilligung und Zwang in der forensischen Psychiatrie unter medizinethischen Aspekten |
| 19.06. | Prof. Ralf Becker (Uni Ulm) | Leib und Leben |
| 03.07. | PD Dr. Hans-Georg Hofer (Uni Bonn) | Der Arzt als therapeutischer forscher: Paul Martini und die Verwissenschafltichung der klinischen Medizin |
| 17.07. | Sabine Schaller (HS Magdeburg) | Verinsbasierte Alkoholprävention in Magdeburg im ausgehenden 19. Jahrhundert und bis 1933 |
| 09.10. | Dr. Jeanette Madarasz-Lebenhagen (Uni Mainz) | Ungleiche Herzen? Geschlechterbilder zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den beiden deutschen Staaten seit ca. 1970 |
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6 (Michelsberg),
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
10.10. | PD DR. Christian Lenk (Ulm) | Ethische Aspekte der Kommerzialisierung von Körpermaterialien |
24.10. | Dr. Urs-Vito Albrecht (MPH) | Die Praxis der Ethikkommission am Beispiel der MHH (Arbeitstitel) |
28.11. | Philipp Rauh (Erlangen) | Von der Ideologisierung der Arbeitskraft. Ernst Wilhelm Baader und die Leistungsmedizin im Nationalsozialismus |
05.12. | Rudolf Breuer (Ulm)
| Die Plagiat-Technik des Ulmer Stadtarztes Dr. Frank |
12.12. | Georgia Hinterleitner | Der Abgrund der (Ab)scheu: Körperliche Entstellung in Videospielen |
13.02. | Dr. Gisela Badura-Lotter (Ulm) | Kinderwunsch und Elternschaft bei psyhisch Kranken - eine Topographie ethischer Konfliktlagen |
13.03. | Judith Steinhardt | „Ärztliches Wartezimmer“ (Arbeitstitel) |
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6 (Michelsberg),
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
11.04. | Dr. Steffi Sachse | Genese prosozialen Verhaltens - Überblick über die entwicklungspsychologische Sicht auf Moralentwicklung |
25.04. | Felicitas Söhner | Guajakholz in der Syphilisgeschichte |
02.05. | Dr. Igor Polianski | Der "gute" Arzt. Ärztlicher Moralhaushalt seit der frühen Neuzeit |
09.05. | PD Dr. Eberhard Wolff
| Medikale Landschaften. Das Sanatorium als gedachte und gelebte Gesundheitsgeographie |
23.05. | Dr. Igor Polianski | Ethik und Psychotechnik: Die psychophysiologische Einheit als medizinethische Leitkategorie in der Sowjetunion und DDR |
30.05. | David Klöpfer | Anwendung und Erfolg des biopsychosozialen Modells in der niedergelassenen Praxis |
20.06. | Dr. Thorsten Noack | NS-Euthanasie und internationale Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung der Behinderten- und Krankenmorde in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. |
18.07. | PD Dr. Michael Knipper | Ethnographie und Medizin (Arbeitstitel) |
12.09. | Dr. Uta Bittner | Philosophie und Struktur der Liebe |
| 26.09. | PD Dr. Jens Clausen (Uni Tübingen) | Schnittstellen zum Gehirn - Neurotechnik und Neuroethik |
Beginn: 10:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6 (Michelsberg),
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
05.10. | Dr. Christine Wolters | Behinderung als gesellschaftliche Herausforderung. Die Integration von gliedmaßenamputierten Kriegsversehrten in der Bundesrepublik nach 1945 |
19.10. | Sebastian Kessler | Die Entpolitisierung des Medikalen? Soziale Ungleichheit und Krankheit im Blickpunkt zwischen Medizin und Politik |
02.11. | Dr. Sascha Dickel | Auf dem Weg in die Enhancement-Gesellschaft? |
16.11. | Julia Bellmann
| Jüdische Urologen im Nationalsozialismus |
07.12. | Dr. Philipp Osten | Stuttgarter Leibärzte und eine Somnambule aus Ulm im Winter |
18.01. | Petra Vetter, | Form und Reichweite der Patientenverfügung |
01.02. | Prof. Dr. Johannes Fischer | Medikalisierung und das Verständnis von Krankheit und Gesundheit |
15.02. | Lena Kroeker | In between Life and Death? - HIV-infizierte Schwangere in |
29.02. | Prof. Elmar Brähler | Impact-Factor: Wahn oder Wirklichkeit? |
Beginn: 12:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6 (Michelsberg),
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig
Datum | Referent | Thema |
06.04. | Dr. Helmut Gröger | Die Entwicklung der psychischen Hygiene zur |
13.04. | Alexander Bagattini | "Autonomie und Erziehung" |
20.04. | Dr. Rouven Porz | Zur Implementierung von Ethikstrukturen in Bern - ein |
11.05. | Matthis Krischel | Zitationsanalyse als soziale Netzwerkanalyse in der Wissenschafts- und Medizingeschichte |
25.05. | Anja Spickereit | Todesursachen in Leichenpredigten und Sterbeverzeichnissen in ausgewählten ehemaligen Reichsstädten im Allgäu des 17. und 18. Jahrhunderts |
01.06. | Dr. Gisela Badura-Lotter | Der professionelle Diskurs zu Kinderwunsch bei psychisch Kranken |
15.06. | Dr. Nicola Wenige | Vom Tatort zum Lernort. Die KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg Ulm |
22.06. | Prof. Dr. Hubertus Büschel | Mediziner in Afrika. Habitus in der Entwicklungszusammenarbeit zwischen 1920 bis 1975 |
06.07. | Daniela Martin | Patientenmorde im "Dritten Reich": Das Beispiel von Anna L. (1893-1940) |
13.07. | Dr. Christiane Imhof | Versuch einer Standortbestimmung |
27.07. | Marisa Münch | Geschichtswissenschaft im Kontext globaler Zusammenhänge: eine Kurzstudie zu computergestützter Methodik am Beispiel einer transeuropäischen Medizinerkonstellation der Frühen Neuzeit |
07.09. | Dr. Michael Kölch | Aufgaben der Ethikkommission: Klinische Prüfungen und Forschung an Minderjährigen |
21.09. | Maria Schmitz | Medizin und Strafe: externe Kinder im Ulmer Fundenhaus |
28.09. | Dr. Elisabeth Balint | Die 'Ephemeris' des Dr. Franc - Tagebuch ganz anders |
Beginn: 12:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort:
Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6 (Michelsberg),
89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
27.10. | Celia Spoden | Wer entscheidet? Eine Fallstudie zu Patientenverfügungen und Entscheidungsfindungen in Japan |
03.11. | Filmvorführung und | Ich klage an! (Dt. 1941) |
10.11. | Dr. Hana Bohn | Shared Decision Making |
17.11. | Dr. Michael C. Schneider | Forschung in Unternehmen der chemischen Industrie |
24.11. | Dr. Frank Kressing | Auffassungen von Krankheit und Tod im Islam sowie deren Relevanz für die bundesdeutsche Krankenversorgung |
01.12. | Dr. Helmut Braun | Genese und Ausbreitung der extrakorporalen Stosswellenlithotripsie (ESWL) in Deutschland |
05.01. | Filmvorführung und | Akademiemitglied Ivan Pavlov (SU 1949) |
19.01. | PD Dr. Kay Peter Jankrift | Die Pest in Oberschwaben. Befunde und Forschungsperspektiven |
26.01. | Ulrike Huhn | Die Kirche als Apotheke? Praktiken der Volksmedizin im Nachkriegsrussland |
02.02. | Christiane Lembert-Dobler | Sprach- und Integrationsmittler im Gesundheitsbereich - eine Notwendigkeit für die Bundesrepublik Deutschland? |
09.02. | Filmvorführung und | Sauerbruch – Das war mein Leben (Dt. 1954) |
16.02. | Prof. Dr. Franz Porzsolt | A Taste of Clinical Economics |
23.02. | Dr. Rouven Porz | Zur Implementierung von Ethikstrukturen in Bern - ein hermeneutisch-narrativer Ansatz |
09.03. | Filmvorführung und | Bestie Mensch (Fr. 1938) |
16.03. | Alexander Bagattini | "Kindliches Wohlergehen im Recht und in der Medizin? Ein Vergleich aus ethischer Perspektive" |
Beginn: 12:00 Uhr (c.t.)
Veranstaltungsort: Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und
Ethik der Medizin, Universität Ulm, Frauensteige 6 (Michelsberg), 89075 Ulm
Keine Anmeldung notwendig.
Datum | Referent | Thema |
28.04. | Matthis Krischel | Frankenstein, or The Modern Prometheus: Promise and Fear of Electricity in Medicine |
05.05. | Prof. Dr. Günter Fröhlich
| Die Vielzahl der ethischen Begründungsansätze und die klinische Ethik |
12.05. | Dr. Margarete Vöhringer | Was hat der physiologische Reflex mit Kunst, Medien und Politik zu tun? Sergej Tschachotins ästhetische Vermittlungen zwischen Russland und Deutschland, 1932-39. |
19.05. | Dr. Hana Bohn
| Shared Decision Making |
16.06. | Dr. Hans-Dieter Lippert | Medizinrecht und Medizinethik: Grenzfälle und Wechselwirkungen (vorläufiger Titel) |
07.07. | Dr. Claudia Peter
| Frühgeburtlichkeit - Alltagsweltliche Hintergründe bei Entscheidungen über Therapiebegrenzungen. Soziale Regeln und implizite Natürlichkeitskonzepte |
21.07. | Florian Braune | Informed consent im kulturübergreifenden Vergleich |
15.09. | Dr. Hans-Klaus Keul
| Was heißt es, Ethik anzuwenden? (vorläufig) |
22.09. | Andrea Quitz
| Staat, Macht, Moral. Die Medizinethik in der DDR |
29.09. | Dr. Pia Schmücker
| Nietzsches Krank-Sein in medizinhistorischer Perspektive |
Veranstaltungsreihen
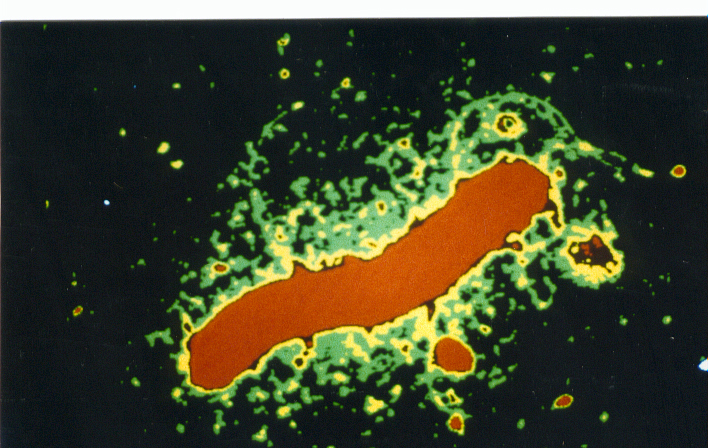
Vortrag der Scultetus-Gesellschaft am 15. November im Kornhaus / Eintritt ist frei
Die Epidemiologie und der Magenkeim Helicobacter pylori stehen im Zentrum des diesjährigen Vortrags der Scultetus-Gesellschaft, für den Prof. Dr. med. Dietrich Rothenbacher, Master of Public Health (MPH) und Direktor des Instituts für Epidemiologie und Med. Biometrie der Universität Ulm, als ausgewiesener Experte gewonnen werden konnte.
Zu seinem Vortrag „Von der Ursachenforschung zur Prävention – Arbeitsweise der Epidemiologie am Beispiel des Magenkeims Helicobacter pylori“ sind Interessierte
am
Donnerstag, 15. November 2012,
um 19:30 Uhr im Kornhaus Ulm
(Kornhausplatz, 89073 Ulm)
herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen:
Die Epidemiologie befasst sich mit der Ermittlung von Krankheitshäufigkeiten in definierten Gruppen und der Aufdeckung von Risikofaktoren, um Ansätze zur Prävention zu finden. Helicobacter pylori ist ein spiralförmiges Bakterium, das im Magen des Menschen siedeln kann. Die Infektion verursacht meist keine Beschwerden, ist aber für nahezu alle Zwölffingerdarmgeschwüre und ca. 80% der Magengeschwüre verantwortlich. Die Infektion spielt bei der Entwicklung des distalen Magenkrebses (am Magenausgang) eine Schlüsselrolle.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ca. die Hälfte der Weltbevölkerung infiziert. Der Vortrag zeigt am Beispiel der Geschichte des Magenkeims Helicobacter pylori, wie mit epidemiologischen Methoden Krankheitsursachen und Risikofaktoren identifiziert werden können. Es wird dabei auch klar, wie medizinisches Wissen einem ständigen Wandel unterworfen ist. Am Magenkeim Helicobacter pylori wird auch deutlich, wie eng Krankheit und Krankheitsverständnis mit dem Wissen um salutogene Faktoren (Salutogenese = Gesundheitsentstehung) zusammenhängen. Speziell der Magenkeim Helicobacter pylori ist hierfür ein gutes Modell, da er sowohl krankmachendes als auch gesundheits-förderndes Potential hat.
Vortrag von Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdoldt anlässlich der Jahresveranstaltung der Scultetus-Gesellschaft am 24. Nov. 2011
Seuchen waren die mit Abstand größten gesundheitlichen Bedrohungen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft. Keine andere Krankheit hat jedoch so sehr in das Schicksal der Menschheit eingegriffen und das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben beeinflusst wie die Pest. Seit der großen Pestkatastrophe zwischen1347 und 1353 hat die Plage Europa mehrfach in Wellen überfallen. Damals raffte die Seuche ein Drittel der Bevölkerung des Kontinents dahin. Einfallstore der Pest waren vor allem die großen Hafenstädte wie Genua und Venedig. Zehntausende von Venezianern starben 1348 an der Epidemie.
Venedig gilt spätestens seit dem 19. Jahrhundert als Stadt der bildenden Künste schlechthin – Jakob Burckhardt und andere Gelehrte und Reisende haben zu diesem Bild nachhaltig beigetragen. Die Nachtseiten der Stadt scheinen eher literarisch belegt; der „Tod in Venedig“ wird nicht nur bei Thomas Mann thematisiert. Viele Werke der bildenden Kunst verdanken, was allzu leicht vergessen wird, ihre Existenz im weitesten Sinn der Pest.
Pest und Kunst, Tod und Schönheit gehen so eine geheimnisvolle Verbindung ein, die im Vortrag dargelegt wird. Das berühmte Stadtbild wäre ohne die zahlreichen Seuchenkatastrophen anders. Unzählige Bilder, die Redentorekirche wie Santa Maria della Salute sind auch Denkmäler großer Not.
Zur Person des Vortragenden:
Prof. Klaus Bergdoldt lehrt Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität zu Köln. Er studierte Medizin in Tübingen, Wien und Heidelberg. 1975 erfolgte die Promotion zum Dr. med. Nach Facharztausbildung zum Augenarzt studierte er Geschichte, Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und Religionswissenschaften in Heidelberg und Florenz. 1986 promovierte er zum Dr. phil. Von 1990 bis 1995 war Bergdoldt Direktor des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Seit 1995 ist er Direktor des Instituts für Geschichte und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln.
Aus der großen Zahl seiner Schriften sind zu erwähnen:
Der schwarze Tod in Europa: Die Große Pest und das Ende des Mittelalters, C.H. Beck,
München 1994
Leib und Seele: Eine Kulturgeschichte des gesunden Lebens, C. H. Beck, München 1999
Das Gewissen der Medizin: Ärztliche Moral von der Antike bis heute, C.H. Beck, München 2004
Die Pest: Geschichte des schwarzen Todes, C. H. Beck, München 2006
Die VHS Ulm, das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und das Zentrum Medizin und Gesellschaft veranstalten
ab dem 10.11.2010
jeden Mittwoch um 20:00 Uhr
im Einsteinhaus der Ulmer Volkshochschule
Abende zum Thema „(Wider) Die Allmacht der Gene“.
Achtung! Bitte beachten Sie, dass der Vortrag von Prof. Gänsbacher vom 2.12.2010 auf einen unbestimmten Termin verschoben wird.
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.vh-ulm.de/ oder entnehmen Sie unserem Flyer.
Ringvorlesungen
Ringvorlesung der Scultetus Gesellschaft des Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Wintersemester 2012/13
Beginn: 18:30 Uhr
Veranstaltungsort: Villa Eberhardt (Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm)
Mit freundlicher Förderung der Jörg-Vollmar-Stiftung.
Ringvorlesung des Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Sommersemester 2012
Beginn: 18:30 Uhr
Veranstaltungsort: Forschungsgebäude N27, Multimediaraum (James-Franck-Ring / Meyerhofstraße, Oberer Eselsberg, 89081 Ulm)
Gemeinsame Ringvorlesung des
- Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ)
- Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums (EPG) und
- Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (GTE)
Die Vorträge finden dienstags 18:30 - 20:00 Uhr im Multimediaraum des neuen Forschungsgebäudes, Universität Ulm Ost, statt.
Das Thema im Sommersemester: „Mythos Europa?“
Weitere Informationen zu den Einzelvorträgen finden Sie auf der Homepage des Humboldt-Studienzentrums.
Gemeinsame Ringvorlesung des
- Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ)
- Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums (EPG) und
- Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (GTE)
Thema: Philosophie und Physik - eine Frage der Übersetzbarkeit
Die Vorträge finden dienstags 18:30 - 20:00 Uhr im Multimediaraum des neuen Forschungsgebäudes, Universität Ulm Ost, statt.
Gemeinsame Ringvorlesung des
- Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ)
- Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums (EPG) und
- Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (GTE)
Thema: DER ERSCHÖPFTE BÜRGER. AMBIVALENZEN DER DEMOKRATIE
Alle interessierten Zuhörer sind hierzu herzlich eingeladen!
Die Vorträge finden dienstags 18:30 - 20:00 Uhr im Multimediaraum des neuen Forschungsgebäudes, Universität Ulm Ost, statt.
Vorträge
Demokratie als Gegengift für’s Kapital
Prof. Dr. Manfred Lauermann
Universität Hannover
17.Mai 2011
Bürger in der Revolte. Zum postdemokratischen Klimawechsel
Prof. Dr. Karlfriedrich Herb
Institut für Politikwissenschaften
Universität Regensburg
24. Mai 2011
„Über die Grenzen von Demokratie und Selbstbestimmung- Tocquevilles „Notbehelf“: Sitten und Gewohnheiten“
Prof. em. Dr. Michael Hereth
ehemals Professor für Politische Wissenschaft
Hochschule der Bundeswehr, Hamburg
31.Mai 2011
Gefährdung der Bürgerlichkeit
Prof. em. Dr. Karl Albert Schachtschneider
Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Politische Wissenschaft
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr, Hamburg
31. Mai 2011
Demokratie und Stadt
OB Ivo Gönner
Oberbürgermeister der Stadt Ulm
21. Juni 2011
Krisensymptome der repräsentativen Demokratie. Lassen sie sich mit deliberativen Verfahren überwinden?
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Claus Offe
ehemals Professor of Political Sociology
Hertie School of Governance, Berlin
28. Juni 2011
Vom Willkommen der Bürger in der Demokratie
Prof. em. Dr. Christian Meier
ehemals Professor für Alte Geschichte
Universität München
05. Juli 2011
Demokratie und globale Megatrends – wohin geht die Reise?
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher
Leiter des Instituts Datenbanken und Künstliche Intelligenz
Universität Ulm
12. Juli 2011
zurück zur Übersicht
Ringvorlesung des Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Wintersemester 2010/11: Teil II
Beginn: 18:30 Uhr.
Veranstaltungsort: Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm, Frauensteige 6, 89075 Ulm.
Gemeinsame Ringvorlesung des
- Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ)
- Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums (EPG) und
- Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (GTE)
GERECHTIGKEIT
Alle interessierten Zuhörer sind hierzu herzlich eingeladen!
Die Vorträge finden dienstags 18:30 - 20:00 Uhr im Multimediaraum des neuen Forschungsgebäudes, Universität Ulm Ost, statt.
Vorträge
| Gerechtigkeit in der Antike Prof. Dr. Günther Bien Humboldt-Studienzentrum/ Institut für Philosophie Universitäten Ulm/Berlin 02. November 2010 | Gerechtigkeit und das Recht der Menschenrechte Prof. Dr. Hans Jörg Sandkühler Leiter der Deutschen Abteilung Menschenrechte und Kulturen des europäischen UNESCO-Lehrstuhls für Philosophie/Paris Institut für Philosophie Universität Bremen 14. Dezember 2010 |
Die Gerechtigkeit des Stachelschweins. |
„Nicht der bessere soll gewinnen, sondern Schalke“. |
Was macht eine Theorie der Gerechtigkeit aus? |
Medizinische Diagnosen und Gerechtigkeit |
Gerechtigkeit und Theologie |
Gerechtigkeit als Fairness |
Gerechtigkeit in der Wirtschaft |
Ringvorlesung des Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Sommersemester 2010
Beginn: 18:30 Uhr.
Veranstaltungsort: Seminarraum des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm, Frauensteige 6 (Michelsberg), 89075 Ulm
03. Mai | Dr. Robert Bud, University of London/Science Museum London | Science, meaning and myth in the museum
|
19. Mai | Prof. Dr. Constantin Goschler, Ruhr-Universität Bochum | (Un)gleichheit als Naturexperiment. Die Popularisierung der Zwillingsforschung und die Debatte um "Vererbung und Umwelt" |
07. Juni | Dr. Wolfgang Antweiler, | Medizin - Kunst – Museum. Ein Museumskonzept als Strategie am Beispiel des Wilhelm-Fabry-Museums |
05. Juli | Prof. Dr. Hans-Konrad Schmutz, Naturmuseum Winterthur (Schweiz) | Fossile Legionäre und Riesenknochen - Zur Objekttransformation in naturhistorischen Sammlungen |
- des Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ)
- Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)
- des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (GTE)
Thema: Geist und Gehirn. Kognitionswissenschaften und Ethik
Alle interessierten Zuhörer sind hierzu herzlich eingeladen!
Die Vorträge finden dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr im Multimediaraum im Forschungsgebäude N27 statt.
Vorträge
27. April 2010
| 22. Juni 2010 Prof. Dr. Heiner Fangerau Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm “Implanted Minds: Das Gehirn, der Geist und regenerative Medizin“ |
04. Mai 2010
| 29. Juni 2010 Prof. Dr. Günter Ehret Institut für Neurobiologien Universität Ulm “Neurobiologische Grundlagen von Geist, Bewusstsein und Ich“ |
11. Mai 2010
| 6. Juli 2010
|
| 08. Juni 2010 Prof. Dr. Jan Schapp Professur für Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie Justus-Liebig-Universität Gießen “In Geschichten verstrickt. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie bei Wilhelm Schapp“ | 20. Juli 2010 Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III Universität Ulm “Soziale Neurowissenschaft“ |
Das Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften plant in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin (Institutsdirektor Prof. Dr. Heiner Fangerau) und dem Studium Generale für das Wintersemester 2009/2010 eine Ringvorlesung zum Thema „Alternative Konzepte in der Medizin.“
Vor dem Hintergrund einer naturwissenschaftlichen und technischwissenschaftlichen Orientierung der Universität Ulm ist das Humboldt- Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften aus der Überlegung entstanden, dem Universitätsgedanken im Sinne einer möglichst umfassenden Bildung gerecht zu werden. Mit seinem Lehrangebot erweitert das Humboldt-Studienzentrum die fachwissenschaftliche Ausbildung in Form zeitgemäßer akademischer Bildung. Ein enger Kooperationspartner ist bereits das neu gegründete Institut für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin der Universität Ulm. Wir haben dieses Oberthema ausgewählt, weil alternative und teilweise auch exotische Heilverfahren immer wieder und so auch im Moment ihre Konjunktur haben. Diese Vorlesungsreihe möchte verschiedene Ansätze vorstellen und deren Seriosität und ihre Kompatibilität mit der sogenannten Schulmedizin untersuchen.
Die Vorträge finden dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr im Raum N 24 / 251 statt.